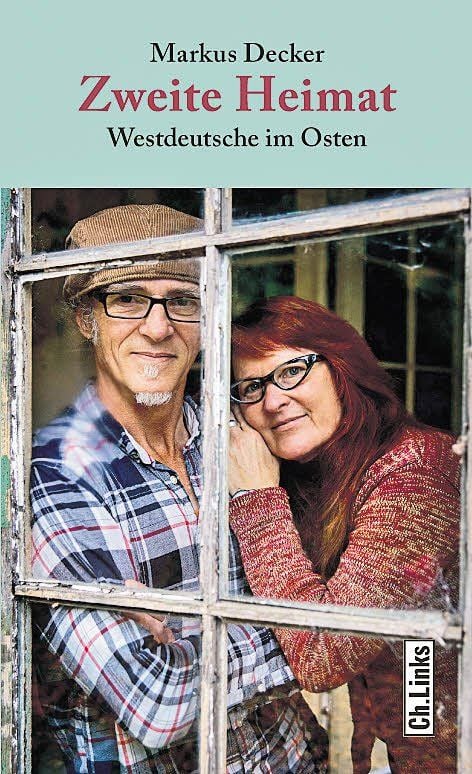Wendegeschichten von Markus Decker Wendegeschichten von Markus Decker: Onkel Herbert aus der Zone

Halle (Saale) - Mein erster Kontaktmann zu denen da drüben war Onkel Herbert. Unser Nennonkel kam aus Bernterode im thüringischen Eichsfeld. Er kam, wie meine Eltern sagten, aus der „Ostzone“. Und weil ich noch klein war und mir unter der „Ostzone“ nichts vorstellen konnte, erschien es mir, als käme Onkel Herbert aus dem Nichts. Ich erinnere mich, dass er als Geschenk meist Lederwaren mitbrachte, Brieftaschen und solche Sachen. Noch mehr erinnere ich mich an sein Holzbein. Denn Onkel Herbert hatte im Zweiten Weltkrieg ein Bein verloren und trug seither eine Prothese.
Da er, wenn er aus der „Ostzone“ kam, immer in unserem Zimmer schlief, warteten wir mit dem Einschlafen so lange, bis er sich auszog. Dann lugten wir heimlich unter der Bettdecke hervor und konnten sehen, wie Onkel Herbert das Holzbein ablegte. Für eine Weile gingen die Worte „Ostzone“ und Holzbein in meinem Kinderkopf eine Synthese ein. Das war in den frühen 70ern, in Borghorst im Münsterland.
In den späten 70ern fing ich an, mich zu politisieren. Der Warschauer Pakt rüstete mit atomar munitionierten Mittelstreckenraketen des Typs SS 20 auf, die Nato wollte mit Pershing-II-Raketen dagegenhalten. Ich fand Letzteres nicht richtig, mein Vater schon. Wir stritten uns. Was mein politisches Interesse weiter steigerte.
Ostraketen sind besser
Im Sommer 1983 machte ich Abitur. Und im Frühherbst desselben Jahres lud mich ein Freund zu einem Jugendlager der Freien Deutschen Jugend nach Werder an der Havel ein. Mein Freund war Mitglied der Jungdemokraten. Das war damals die durchaus linke Jugendorganisation der FDP. Und weil in deren Delegation noch ein Platz frei war und die „Ostzone“ mich interessierte, sagte ich zu. Vorn auf dem Podium saßen FDJler, die locker auf die 50 zugingen und auf einen 19-Jährigen auch sonst etwas sonderbar wirkten. Ihnen zu Füßen saßen Vertreter westdeutscher linker Jugendorganisationen, die ungefähr so dogmatisch argumentierten wie die FDJ – bis auf uns, die Jungdemokraten. Man war übereinstimmend der Ansicht, dass der Osten allemal besser sei als der Westen und Ostraketen allemal besser seien als Westraketen.
Als Kontrastprogramm und um etwas Luft zu schnappen, besuchten wir die Ständige Vertretung der Bundesrepublik in der DDR in Ost-Berlin, in deren Umgebung es von Volkspolizei und Staatssicherheit nur so wimmelte. Dort hörten wir von der allgegenwärtigen Repression, die in Werder unterschwellig zu spüren war.
Mein linker Idealismus war nach der Tour kleiner als vorher. Dies änderte an meinem Interesse für den Osten aber nichts. Ich besuchte Moskau und Prag. In Moskau habe ich den Besuch des Leninmausoleums verschlafen. Aus Prag ist mir die Ruhe erinnerlich und dass wir viel Bier getrunken haben.
Angst vor dem Nationalen
Dann verschwand die Mauer. Ich saß von Donnerstagabend bis Freitagabend in meinem Münsteraner Wohngemeinschaftszimmer begeistert vor dem Fernseher, nachdem das SED-Politbüromitglied Günter Schabowski am 9. November den berühmten Zettel hervorgekramt hatte. Schließlich habe ich es nicht mehr ausgehalten, bin nach Berlin gefahren und stundenlang an der bröckelnden Staatsgrenze rumgelaufen. Es war großartig. Zurück in der Heimat, diskutierte ich mit meinen linken Kommilitonen erhitzt über die Frage, ob das mit der Vereinigung seine Richtigkeit habe. Sie betrachteten das Ganze skeptisch, ich weniger. Unsere Generation fürchtete alles Nationale wie der Alkoholiker die Weinbrandbohne.
Es folgten die ausländerfeindlichen Exzesse von Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen. Ich saß wie an jenem 9. November erneut vor dem Bildschirm und bekam es mit der Angst zu tun. Hatten meine Kommilitonen Recht behalten? In dieser Zeit endete auch mein Studium. Ich begann, mich um ein Zeitungsvolontariat zu bewerben. In Ostdeutschland hatte ich vier Vorstellungsgespräche: in Magdeburg, Schwerin, Neubrandenburg und Halle. In Westdeutschland kein einziges. Ich konnte zwischen einem Job in Neubrandenburg und einem in Halle wählen. Und so kam ich, der Wendegewinnler, zur Mitteldeutschen Zeitung ins soeben erstandene Sachsen-Anhalt. 1992 war das.
Auf Seite 2 erfahren Sie mehr über Sachsen-Anhalt in den frühen Neunzigern und unbekannte Christen
Der Osten war grau in jener Zeit, viel grauer als heute. Von Magdeburg bis Bernburg, wo ich mein Volontariat in der Lokalredaktion begann, brauchte man wegen der schlechten Verkehrsverbindungen drei Stunden – für 40 Kilometer. Im Winter roch es überall nach Kohle. Und wenn zwei meiner sieben Kollegen telefonierten, mussten wir anderen sechs warten. Denn es gab bloß zwei Leitungen. Manche meiner Ost-Kollegen waren in der SED und schon vor der Wende bei jener Zeitung, die seinerzeit noch Freiheit geheißen hatte. Sympathisch waren sie alle, und ich sah mich außerdem nicht berechtigt, ihnen bohrende Fragen zu stellen. Auch wenn ich es theoretisch hätte tun können.
Ich war erst 28 und von der DDR-Vergangenheit völlig unbelastet. Ich schrieb mir die Finger wund und schaffte endlich, was ich hatte schaffen wollen: mich zu lösen von der Scholle. So vieles war anders und wahnsinnig interessant. Es war wie ein Rausch. Ja, ich war jetzt in der „Ostzone“. Freunde bemitleideten mich. Ich jedoch fühlte mich so gut wie lange nicht. Ich war frei. Ich war high. Und ich merkte, dass diese neue Welt etwas mit mir machte.
Nach zwei Jahren wurde ich von Bernburg in die Lutherstadt Wittenberg geschickt. Ich war nicht mehr Volontär. Ich war nun Redakteur. In Wittenberg lernte ich Christen einer Spielart kennen, die mir in der katholischen Heimat unbekannt geblieben waren. Sie nannten sich Protestanten. Ein Mann namens Friedrich Schorlemmer war der Bekannteste unter ihnen. Auch traf ich bald den Arbeitsamtsdirektor. Der hieß Reiner Haseloff, war wie ich Katholik und ist heute Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Wir wohnten in derselben Straße, an deren Ende sich die katholische Kirche befindet. Sein offensiver Katholizismus erinnerte mich an zu Hause. Das war vertraut und bedrohlich zugleich.
Im Prenzlauer Berg ist es schön schwierig
Meine Mutter hatte mich vor den Protestanten gewarnt. Ich wolle doch wohl nicht die Seiten wechseln, sagte sie mahnend. Derweil spielten ihr die Protestanten in die Hände – nur anders, als sie dachte. Denn das Erleben von Religiosität aus einer Minderheitsposition heraus war für mich wichtig. Zu Hause war der Katholizismus dominant. Er übte, wo er konnte, Herrschaft aus. Im Osten konnte er keine Herrschaft ausüben. Dazu war er viel zu schwach. Umso mehr merkte ich, dass mir die Kirchenleute, ob protestantisch oder katholisch, die nächsten waren. So konnte ich mich Gott auf einem Schleichweg wieder nähern. Die Wiederannäherung folgte einer Art dialektischem Prinzip. Und mit der Dialektik kannten sie sich im Osten ja aus.
Heute arbeite ich als politischer Korrespondent in (Ost-)Berlin. Da, wo wir leben, in Prenzlauer Berg, ist der Osten verschwunden, vordergründig zumindest. Wo früher ostdeutsche Arbeiter und Künstler zu Hause waren, dominieren jetzt westdeutsche Akademiker aus der Erbengeneration. Die Preise für Wohnraum steigen. Die Klage über das, was Gentrifizierung genannt wird, ist allgegenwärtig. Wer in Quickborn, Schmalkalden oder Berlin-Charlottenburg in den eigenen vier Wänden lebt, muss das nicht erklären. In meiner münsterländischen Heimat schießen seit jeher die Einfamilienhäuser wie Pilze aus dem Boden.
Auch dort muss das keiner erklären. Hier muss er das schon. Denn der Prenzlauer Berg gilt als Laboratorium der Einheit, in dem wieder mal die „Wessis“ die „Ossis“ verdrängen. Jede Bewegung wird mikroskopisch vergrößert. Dabei wuchern die Klischees über mein aus der Ferne betrachtet ach so luxuriöses Leben, in denen ich mich auf unserem in die Jahre gekommenen Ikea-Sofa nicht wiederfinde. Sie zwingen mir eine Scham auf, die grundlos ist. So gesehen ist es schön im Prenzlauer Berg – schön schwierig.
Austausch über das Ost-West-Ding
Ausnahmslos schön ist, dass meine Liebste, eine Ostfrau, beruflich regelmäßig auch im Münsterland zu tun hat, dass es ihr da gefällt und wir uns über das Ost-West-Ding austauschen können. Der Austausch bereichert unser Dasein. Sie stammt aus einem 3 000-Seelen-Dorf mit dem schönen Namen Schweina am Rande des Rennsteigs, wo ich, wenn die ganze Familie beisammensitzt, der einzige Westdeutsche bin. Zuweilen wird mir meine Minderheitsposition bewusst.
Die Eltern meiner Liebsten, die in den 40er Jahren geboren wurden und die Teilung des Landes ebenso erlebt haben wie dessen Wiedervereinigung, berichten viel von früher. Das bringt uns einander näher. Manches erinnert mich an Erzählungen meiner Eltern – wenngleich aus einer entgegengesetzten Perspektive. Manches ist mir fremd und wird mir erst durch Erzählungen allmählich vertraut. Ihr jüngster Enkel, der bald zehn Jahre alt wird, sagt unterdessen, dass er das Wort „Wende“ nicht mehr hören könne. Er meint damit natürlich die 89er Wende. Das ist ein Kommentar aus Kindermund zu den deutsch-deutschen Befindlichkeiten, der für sich spricht. Dem Enkel sind die Befindlichkeiten egal. Er wartet auf seine eigene Geschichte.
Und er kann warten. Meine Liebste kommt übrigens aus Thüringen – wie Onkel Herbert, der im Zweiten Weltkrieg, den er nicht verschuldet hatte, ein Bein verlor und seither ein Holzbein trug. Er konnte nicht mehr warten, sondern war in die Geschichte eingesponnen, erst durch den Krieg und dann durch die Teilung.
In der Küche hoch über Schweina, den ostdeutschen Thüringer Wald hinter mir und die gesamtdeutsche Rhön vor mir, spüre ich, das alles mitbedenkend, über drei Generationen hinweg, dass Geschichte mehr ist als das, was in Büchern steht. Vor allem spüre ich, dass das Glück friedlicher Einheit groß ist. Größer als alle Widrigkeiten, die ihr im Wege sind. (mz)