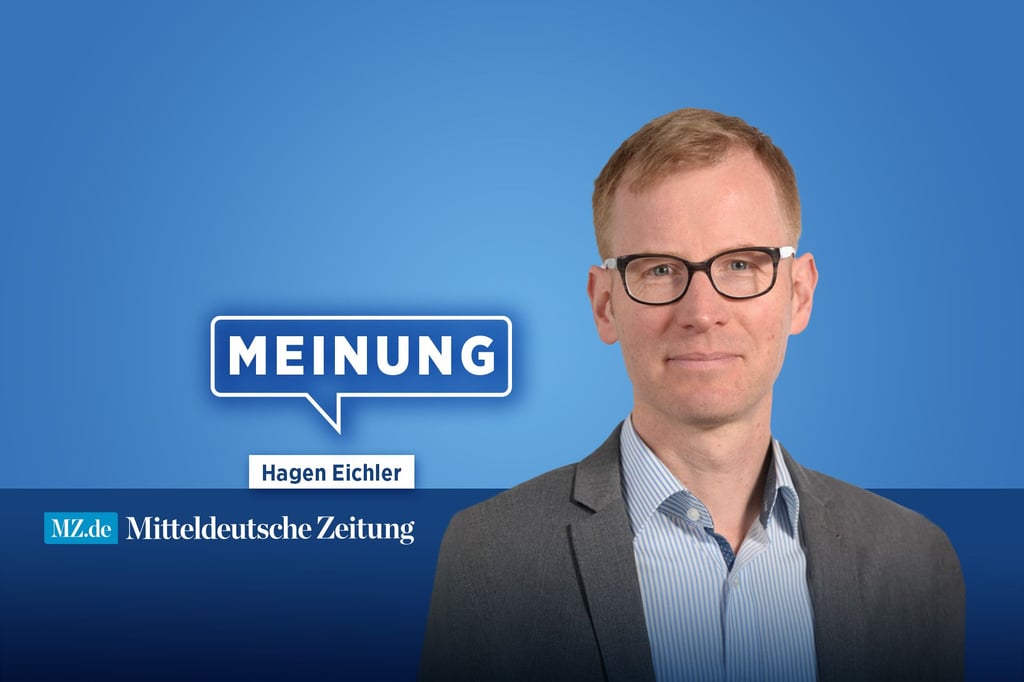Reportage Eisenbahnstraße in Leipzig: Besuch nach der Rockerschießerei

Leipzig - Eine mutmaßlich arabische Großfamilie sitzt auf der Wiese, der Lärm der Kinder geht im Gerumpel einer Straßenbahn unter. Eine Frau mit Kopftuch und Kinderwagen läuft vorüber. Ein Mann im Unterhemd döst in der Sonne, eine Bierflasche in der Hand. Nur der Polizeiwagen, der mitten auf dem Rasen parkt, passt nicht ins Bild.
Leipzig, Otto-Runki-Platz, direkt an der Eisenbahnstraße, östlich des Hauptbahnhofs. Eine kleine Grünanlage mit Spazierwegen.
Der Platz ist eine Art Wurmfortsatz des beliebten Stadtteilparkes Rabet, eine kleine Idylle im Großstadtgetümmel. Und seit Sonnabend vergangener Woche ein Tatort.
Ein Toter, zwei Schwerverletzte - so endete an jenem Tag eine Schießerei auf offener Straße zwischen verfeindeten Rockerbanden. Zwei Männer sitzen in Haft. Sie stehen unter Mordverdacht.
Seitdem sind die Schlagzeilen wieder da: Zur „gefährlichsten Straße Deutschlands“ hatten Boulevardmedien die Eisenbahnstraße schon vor Jahren gekürt - und nun wieder.
Blick in die Kriminalstatistik
Die gefährlichste Straße Deutschlands? Im vergangenen Jahr zählte die Kriminalstatistik in den Stadtvierteln rund um die Eisenbahnstraße 56 „Rohheitsdelikte“ und „Straftaten gegen die persönliche Freiheit“, darunter fallen Raub und Körperverletzung.
Im Jahr zuvor waren es 62 derartige Delikte. Für die Polizei bleibt die Gegend ein Kriminalitäts-Schwerpunkt; Spitzenreiter ist allerdings die Innenstadt.
In der Eisenbahnstraße ist es die Art der Delikte, die Aufsehen erregt - und die Meile regelmäßig in die Schlagzeilen spült: Immer wieder Massenschlägereien, Messerstechereien, meist zwischen ausländischen Banden. Drogendelikte, nicht zu vergessen. Stoff, sagen Einheimische, bekommt man hier an jeder Ecke.
Aber gefährlich? Zunächst mal ist die Eisenbahnstraße eine Straße, die brummt: Imbiss an Kneipe an Telefonshop an Ramschladen an Gemüseladen. Hier ein türkisches Kulturcafé, dort eine Moschee in einer Wohnung.
Viele Häuser sind saniert, vor einigen stehen Gerüste. An einer Straßenecke hat ein Klamotten-Händler die Fassaden mit seiner Ware behängt und so in eine Auslage verwandelt. Menschen schieben sich auf den Gehwegen entlangt - Frauen mit Kopftuch, muskelbepackte Kerle Typ Gangsta-Rapper, Studenten, alte Frauen mit Einkaufswägelchen.
Und immer wieder: Polizei. Streifenwagen patrouillieren die Straße rauf und runter. In einer Parkbucht stehen drei Polizisten um einen tiefergelegten metallic-weißen Mercedes-Kombi. Daneben ein Mann mit Vollbart und blauer Weste, der dreinschaut wie ein bei einem Streich ertappter Schuljunge.
Die Anwohner fühlen sich sicher
Gefährlich? Wer hier lebt oder arbeitet, zeichnet ein anderes Bild: „Als Bürger passiert ihnen hier nichts“, sagt Volkmar Maul, „das sind Banden, die sich bloß untereinander bekriegen!“
Er sagt das mit der Unerschütterlichkeit eines Mannes, dem die Eisenbahnstraße über Jahrzehnte geschäftliche Heimat geworden ist. Maul, 66, ist Augenoptiker, das Geschäft hat er vom Vater übernommen, der nach dem Krieg aus der ausgebombten Innenstadt in den Osten zog.
Der freundliche ältere Herr, Hornbrille, Stirnglatze, verschmitztes Lächeln, hat erlebt, wie die Straße sich verändert hat, nach der Wende, als die Migranten kamen, Russen, Vietnamesen, Araber, die billige Wohnungen suchten.
Der Ausländeranteil liegt hier bei 14 Prozent - fast doppelt so hoch wie in der gesamten Stadt. Aber gefährlich, gar kriminell? „Das sind alles prima Nachbarn hier“, seine Hand beschreibt einen Kreis, „ich habe zu allen ein gutes Verhältnis.“
Jetzt verändert sich das Quartier um die Eisenbahnstraße gerade wieder mächtig. Nachdem in den hippen Vierteln im Leipziger Westen und Süden nicht mehr viel geht, entdecken die Jungen und Kreativen den Osten für sich - binnen zwei Jahren verbuchten die Statistiker einen Zuzug von 3 000 Menschen.
Investoren und selbstverwaltete Hausprojekte liefern sich einen Kampf um die letzten freien Mietskasernen; die Immobilienpreise schießen nach oben.
Das Haus, in dem Volkmar Maul seinen Laden hat, gehört ihm. „Ich werde nicht verkaufen“, sagt er und pocht wie zur Bekräftigung auf den Tresen. Seine Tochter will das Geschäft übernehmen, das von Stammkunden aus der ganzen Stadt lebt. „Mit Optikern ist es wie mit Ärzten“, sagt Maul, „wenn man mal einem vertraut, dann bleibt man bei dem.“
Ein paar Meter die Straße hoch: ein schickes Café, wie es in jedem Ausgehviertel stehen könnte; innen viel Holz und rohe Ziegelmauern, Bistrotischchen, das Angebot auf großen Tafeln. Der Chef trägt graues Hemd zu grauer Anzughose, seine Stimme ist leise.
Eisenbahnstraße? Gefährlich? Er mag das Thema nicht. Er weist Richtung Stadtzentrum, „das ist doch da unten passiert“, er meint die Schießerei, „fragen Sie doch da“. Dann sagt er noch: „Das sind Leute von außerhalb, die die Eisenbahnstraße kaputt machen.“
Initiativen sollen das Image aufpolieren
Vereine, Verbände und die Stadtverwaltung versuchen seit Jahren, gegen den schlechten Ruf anzukämpfen. Mit Quartiersmanagement. Mit einem jährlichen Kunstfest Anfang Juli.
Die Industrie- und Handels- sowie die Handwerkskammer haben mit der Polizei eine „Sicherheitspartnerschaft“ geschlossen, die Beratungsangebote für Geschäftsleute unterbreitet. Dennoch rechnet die IHK nach der jüngsten Gewaltorgie mit kurzfristigen Umsatzrückgängen in der Eisenbahnstraße.
Dabei ist es kaum irgendwo schöner als hier, findet Beate Stoffers. Dem Bild von der „gefährlichsten Straße Deutschland“ setzt die Verkäuferin im Tabakshop Brandt ihr eigenes entgegen: „Das ist eine der freundlichsten Straße, die ich kenne!“
Angst? Stoffers, 55, Kurzhaarfrisur, Kodderschnauze, schüttelt energisch den Kopf. „Angst hab’ ich gehabt, als ich 1989 vor der Stasi demonstriert habe.“ Stoffers sagt, sie liebe das Publikum, die Atmosphäre, das Internationale. „Aber man darf hier nicht auf den Mund gefallen sein.“
Bevor es jetzt zu sozialromantisch wird, betritt ein Mann den Laden; Bart, Bauch, Brille. Er hört eine Weile zu. Und als man ihn fragt, wie er sich denn fühle in der Eisenbahnstraße, antwortet er: „Wenn es sein muss, haue ich zurück.“
Dann zieht er vom Leder: Klein-Istanbul sei das hier, mit den Drogen werde es immer schlimmer, und überhaupt müsse Deutschland jetzt die Grenzen dicht machen.
Beate Stoffers hält dagegen: Grenzen dicht, das gehe doch nicht, mit unserer Geschichte! Jaja, ereifert sich der Mann, dann sind wir wieder alle Nazis! Und schon ist die Eisenbahnstraße angekommen in der deutschen Wirklichkeit 2016.
Draußen fährt schon wieder ein Polizeiauto mit Blaulicht und Sirene vorbei. (mz)