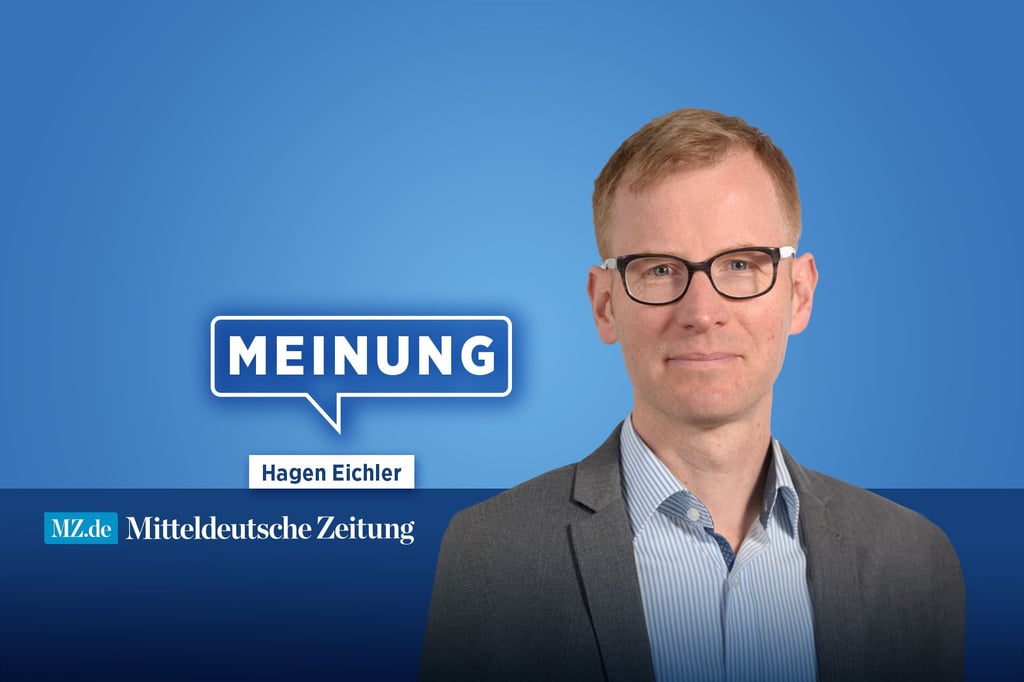Gedenken in Mühlberg Gedenken in Mühlberg: Schwierige Geschichte

Mühlberg - Rund 300 Menschen haben am 1. September in Neuburxdorf an die Schicksale der Gefangenen in den Internierungslagern der NS-Zeit und des Sowjet-Geheimdienstes NKWD mit Gedenkveranstaltungen und einem Gottesdienst erinnert.
Zu Ehren der Opfer des nationalsozialistischen Kriegsgefangenenlagers Stalag IVB und des sowjetischen Speziallagers Nr. 1 in Mühlberg/Elbe wurden Kränze auf dem Soldatenfriedhof in Neuburxdorf und am Hochkreuz an der Gedenkstätte für die Verstorbenen des Speziallagers abgelegt. Darüber informiert Elbe-Elster-Kreissprecher Torsten Hoffgaard.
Unter den Gästen war auch Landrat Christian Heinrich-Jaschinski (CDU), der als Kreisvorsitzender des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge mit Blumengebinden an die Leidensgeschichte der Inhaftierten erinnerte. Beim 28. Mahn- und Gedenktreffen der Initiativgruppe Lager Mühlberg sagte Brandenburgs Staatskanzleichef Martin Gorholt: „Das Besondere hier ist, dass die doppelte Vergangenheit des Ortes bewusst wahrgenommen und aufgearbeitet wird. Hier wird der Blick auf die ganze Geschichte gelenkt, auf die vielen Schicksale der Opfer beider Lager.“ Im ehemaligen Stammlager Mühlberg wurden zwischen 1939 und dem Kriegsende vom nationalsozialistischen Terrorregime tausende Kriegsgefangene, unter anderen Polen, Dänen, Serben, Franzosen, Briten und Sowjetsoldaten interniert.
Im September 1945 übernahm der sowjetische Geheimdienst NKWD den Ort des Grauens und gründete das Speziallager Nr. 1. Bis 1948 wurden über 21000 Menschen ohne rechtsstaatliche Grundlage und ohne Urteil festgehalten. Etwa 7000 starben. Erst seit 1990 ist es möglich, die Geschichte des Lagers zusammen mit den Einzelschicksalen zu ergründen. Der Gedenkort in Neuburxdorf sei zugleich eine Stätte der Erinnerung und der historisch-politischen Bildung, meinte Gorholt. Die Aktivitäten der Initiativgruppe und vieler engagierter Bürgerinnen und Bürger vor Ort trügen dazu bei, Geschichte für junge Menschen und zukünftige Generationen wachzuhalten.
„Das Wichtigste ist, junge Menschen an das Geschehene zu erinnern, ihnen ein Gefühl für die Vergangenheit zu geben. Es kann keinen Schlussstrich geben. Wir müssen heute feststellen, wie schwer es ist dafür zu sorgen, dass Menschen Antworten auf ihre Sorgen und Ängste nicht in Fremdenfeindlichkeit oder Intoleranz suchen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern erfordert unermüdlichen Einsatz“, sagte Martin Gorholt.
(mz)