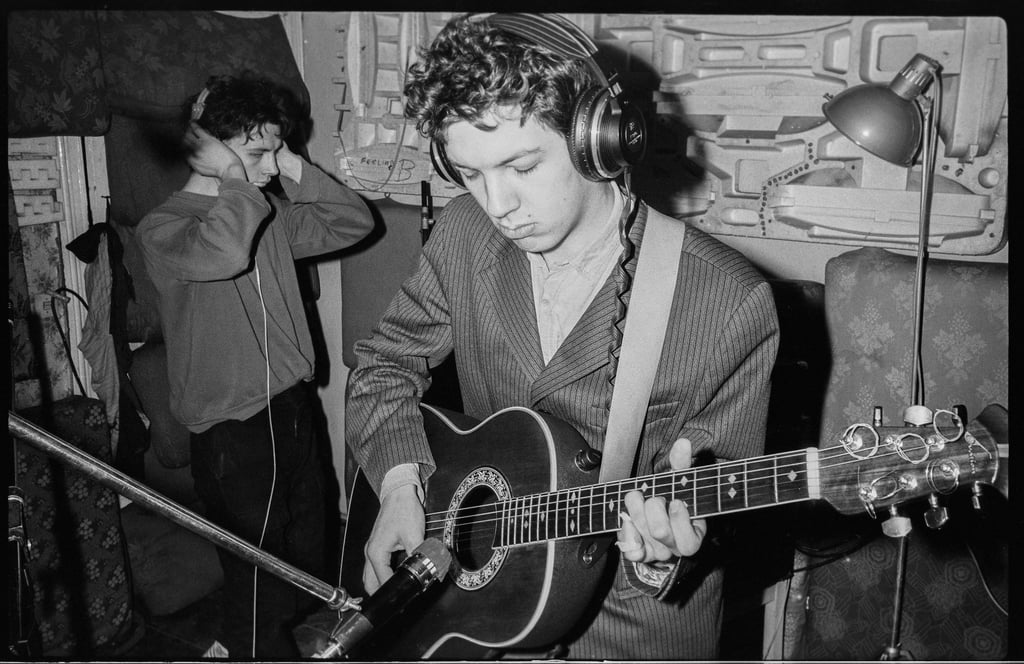Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt: Adel verpflichtet
Magdeburg/MZ. - Den Herren Studiosi muss mulmig gewesen und der Schweiß in Strömen geflossen sein, als sie, nur mit brennenden Kienspänen bewaffnet, in die Unterwelt vorstießen: "Durch dis enge Kluft muss man mit dem Rücken so fest aufdrücken, das man auf dem Bauch hindurch musste", schreibt ein Herr von Alvensleben in antiquiert wirkendem Deutsch Mitte des 17. Jahrhunderts jene Sätze mit Feder und Tinte in ein Hadernpapier-Heftchen aus Lumpen.
Harzreise, 150 Jahre vor Heine
Das 44-seitige Manuskript gilt 350 Jahre später als ein Kleinod des sachsen-anhaltischen Landesarchivs und nach Ansicht von Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) als früheste touristische Überlieferung - lange vor Heines Harzreise 150 Jahre später oder den Expeditionen Goethes ins "Muttergebürg". Von Alvensleben, dessen Vorname unbekannt ist und der aus einem weit verzweigten Adelsgeschlechts aus dem heutigen Sachsen-Anhalt stammt, war 1653 mit einer Gruppe Studenten aus Halle in den Harz aufgebrochen. Wohl im Rahmen einer studentischen Forschungsarbeit, vermutet Archivar Andreas Erb, hätte die Truppe das damals nahezu unerschlossene Gebirge bereist.
Erb hat mit seinen Kollegen Jörg Brückner und Christoph Volkmar erstmals die Adelsarchive im Landeshauptarchiv durchforstet, nach Besonderheiten und Kuriositäten geschaut und alles mehr oder minder leicht verdaulich in einem Wälzer für die Öffentlichkeit aufbereitet. Wer sich von den knapp 400 Seiten nicht erschrecken lässt, hält ein umfassenden Kompendium der Adelsgeschichte Mitteldeutschlands in den Händen: Angefangen von den großen Namen wie Anhalt, Wernigerode oder Bismarck bis hin zu den kleinen Gütern, die dem niedrigen Adel gehörten. Aber auch so illustre Gestalten der deutschen Romantik wie Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg, besser bekannt als Novalis, finden sich darunter. Weder das Archiv selber noch das jetzt vorgelegte Buch sind dabei nur etwas für Blaublut-Fans. Vielmehr richtet sich die Publikation an alle historisch Interessierten, vom Schüler bis zum Heimatforscher.
"Der Adel, gerade auf dem Land, spielte damals eine große Rolle - er war Landbesitzer, übte die öffentliche Gewalt und Richtbarkeit aus, kümmerte sich um Schulen und Kirchen - er war der Staat vor Ort", sagt Archivar Erb. Mit seinen 3 300 laufenden Archivmeter Akten zählen die Adelsarchive in Sachsen-Anhalt zur wohl umfangreichsten Sammlung in ganz Deutschland und seien eine unschätzbare Quelle für eine Zeit, in der die Mehrheit der Bevölkerung auf dem Land lebte, sagt die Chefin des Landeshauptarchivs, Ulrike Höroldt. Zu DDR-Zeiten stiefmütterlich behandelt, begann nach 1989 die wissenschaftliche Aufarbeitung des gewaltigen Fundus. In dem man dann auch auf den Bericht von Alvenslebens stieß.
1 000 Jahre alte Urkunden
Nachdem dieser mit seinen Studenten in Blankenburg den bereits damals ruinösen "Reinstein" - heute als Raubritterburg Regenstein bekannt - besuchte, ging es hinein ins Gebirge. Tief hinein: In die B(a)umannshöhle, wie Alvensleben vermerkt. Das Gesehene muss den Adligen schwer beeindruckt haben: In seinem Reisetagebuch findet sich eine Doppelseite mit eine Karte der Baumannshöhle, in der er mehrfach gewaltige Tropfstein-Formationen verzeichnete. Dazwischen, winzig klein reichlich verloren, eine Handvoll Menschlein - wohl die Reisegruppe selber. So alt von Alvenslebens Reisebericht, der auch einen Aufstieg zum Brocken beschreibt, erscheinen mag - gegenüber den ottonischen Urkunden des Kloster Drübecks mutet die Urmutter des Harzer Baedekers eher wie ein Comic an.
Mehr als 1 000 Jahre haben die ältesten Schriftstücke auf dem Buckel, die das Landeshauptarchiv in klimatisierten Räumen und in Spezialverpackungen verborgen hortet. Mehr als 100 000 Einzelstücke sind es, die nur der Adelsgeschichte zugeordnet werden könnten, ein Großteil ist bis heute nicht ausgewertet. "Da liegen noch Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte Arbeit vor uns", sagt Archivchefin Höroldt. Dass Sachsen-Anhalt über einen solchen Reichtum an Adelsarchiven verfügt, habe vor allem mit der Enteignung der Geschlechter während der Bodenreform nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun.
Höroldt schätzt, dass daher auf 80 Prozent der Archive ein Rückübertragungsanspruch liegt. Mit 45 betroffenen Familien habe man bereits Verträge abschließen können, wonach die historischen Dokumente an Ort und Stelle bleiben können. Nur in einem Fall habe bislang ein Archiv zurückgegeben werden müssen, ein zweiter sei in Verhandlung. Statt der Rückgabe entschlössen sich vielmehr immer mehr Adelshäuser, nicht nur ihre Dokumente im Archiv zu belassen: "Wir bekommen auch ständig neues Material hinzu", sagt Höroldt.