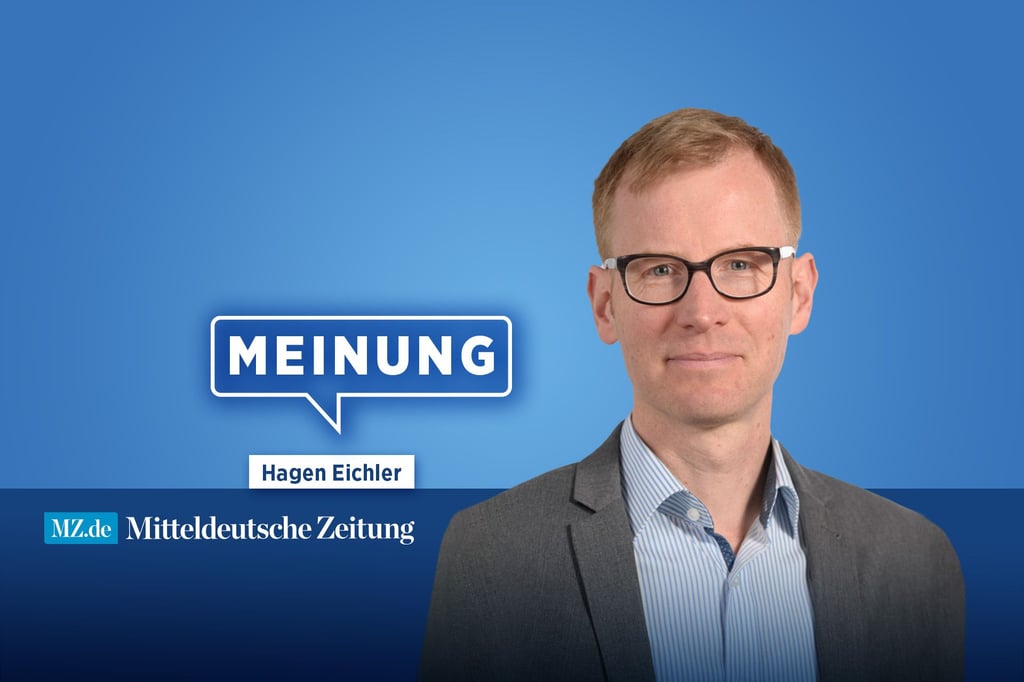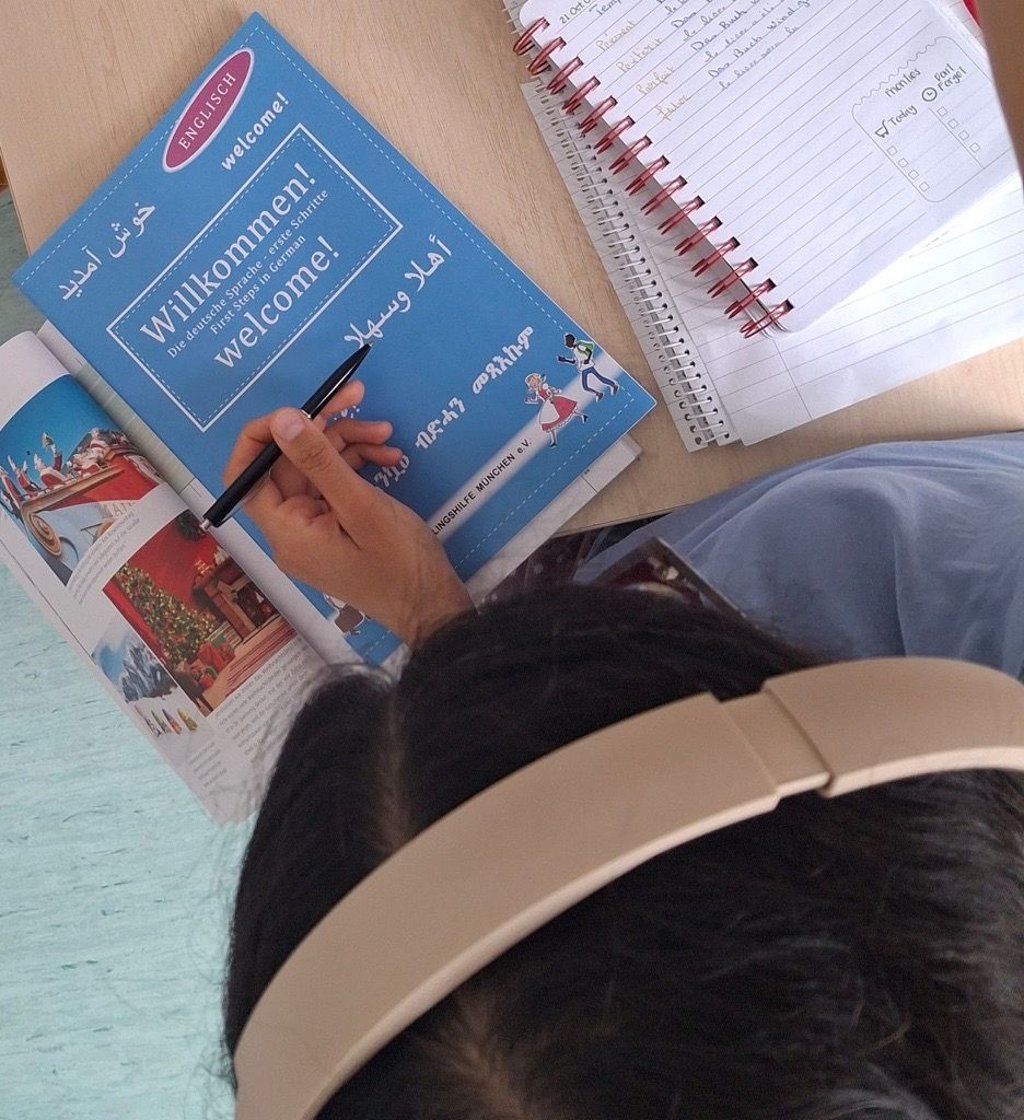Hoffmannscher Ringofen Hoffmannscher Ringofen: Revolution der Ziegelei in Westeregeln

Westeregeln/dpa. - Andreas Beaugrand schnappt sich einen Haken und zieht mit ihm eine Art Stöpsel aus dem Boden. Ein Loch, etwa 15 Zentimeter im Durchmesser, gibt den Blick nach unten frei. Dicke Mauern und in schummeriges Licht getauchte Köpfe sind zu sehen. Die Stimmen klingen dumpf. In Europas längstem noch erhaltenen Hoffmannschen Ringofen stehen Besucher. Sie drängen sich in eine der 28 Kammern, die einen ovalen Kanal bilden. Der Ofen war damals eine Revolution in der Ziegelherstellung und ist nach seinem Erfinder Friedrich Eduard Hoffmann benannt. Mit 122 Metern ist er länger, als der Magdeburger Dom hoch ist. 1894 wird er in der Ziegelei Westeregeln gebaut. Die ist heute Museum - und der Ringofen ein Besuchermagnet.
Einmal angefeuert, wandern die Flammen im Ofen von einer Kammer zur nächsten. Früher lagerten darin Ziegelrohlinge, die getrocknet werden mussten. Temperaturen von bis zu 1200 Grad ließen auch den letzten Tropfen Feuchtigkeit aus den Rohlingen entweichen. „Es geht immer im Kreis“, sagt Beaugrand. „Der Ofen ist eine Art Perpetuum mobile und das Herz des Industriedenkmals.“
Heute kümmert sich die Sozial-Aktien-Gesellschaft (SAG) um die Ziegelei im Salzlandkreis. Beaugrand ist einer der beiden Vorstände. 1997 kaufte die gemeinnützige SAG (Bielefeld) das sieben Hektar große Gelände mit Ziegelei von der Treuhand. Die 1803 errichtete Ziegelei gilt als eine der ältesten in Deutschland. „Wir haben uns gezielt für das Objekt entschieden“, sagt Beaugrand. Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte setzt die SAG bis heute dort um und investierte bislang etwa 600 000 Euro, darunter auch Fördergelder. Aktuell wird an einem neuen Museumskonzept gearbeitet. Es sollen mehr Besucher in das Industriedenkmal kommen. Noch sind es nur wenige.
„Das ist ein Ort mit besonderer Energie“, sagt Beaugrand und legt Haken und Stöpsel auf den Boden. Er meint die Ziegelei im Allgemeinen und den Hoffmannschen Ringofen im Speziellen. Er zeigt mit dem Finger auf das Loch. „Hierdurch hat der Brennmeister immer wieder Kohlestaub durch einen Trichter nach unten gekippt und die Flammen am Leben gehalten.“ Und er hatte gut zu tun. „Entlang des mehr als 120 Meter langen Kanals gibt es 458 Schüttlöcher. Ausgehen durfte das Feuer in der Brennsaison von März bis Oktober nicht.“ Bis 1991 war der Ofen richtig in Betrieb. Zuletzt schafften die maximal 15 Ziegeleimitarbeiter Beaugrand zufolge jährlich etwa 3,2 Millionen Ziegel. „Konkurrenzfähig war das nicht“, sagt er.
Alle 28 Brennkammern münden in einem langen Schornstein. Er wurde erst für 30 000 Euro saniert. Über dem Ringofen befindet sich die Trocknung. Ein durchlöchertes Gebilde, dessen Öffnungen heute mit Glasscheiben aus einer alten Gärtnerei verschlossen sind. Auf dem Dach arbeitet eine Photovoltaikanlage, innen stehen unzählige Regale. Durch die Lüftungsschlitze fällt der Blick auf die Tongrube, die heute Biotop und Geotop ist. Eine kleine Lore und ein senfgelber Bagger zeugen als rostige Mahnmale vom einstigen Ziegeleibetrieb.
Beim Bundesverband der Ziegelindustrie gibt es den Arbeitskreis Historische Ziegeleien. Über Technikdenkmäler wie das in Westeregeln sind die Mitglieder froh, auch wenn direkt kein Geld fließt. „Wir stellen vielmehr den organisatorischen Rahmen, helfen bei Fachfragen und legen unsere Tagungen an diese Orte“, sagt Verbandspräsident Helmuth Jacobi. „Andernorts wurden viele Öfen und Anlagen einfach abgerissen.“ Die Westeregelner Ziegelei selbst ist laut Jacobi ein Vorzeigebeispiel für Ziegeleitechnologie des 19. Jahrhunderts.
Im dortigen Technikraum drückt Beaugrand viele Knöpfe. Behäbig und laut setzt sich ein monströser Apparat in Gang. „Es funktioniert“, sagt der 52-Jährige stolz. Die Mühle für den Ton spuckt immer noch feinen Staub in die Luft, die Strangpresse johlt gequält. „Der Ton kam mit der Grubenbahn aus der Grube, wurde gemahlen, mit Wasser gemischt, gepresst und in Rohlinge geschnitten.“ Dann wartete der Ringofen.