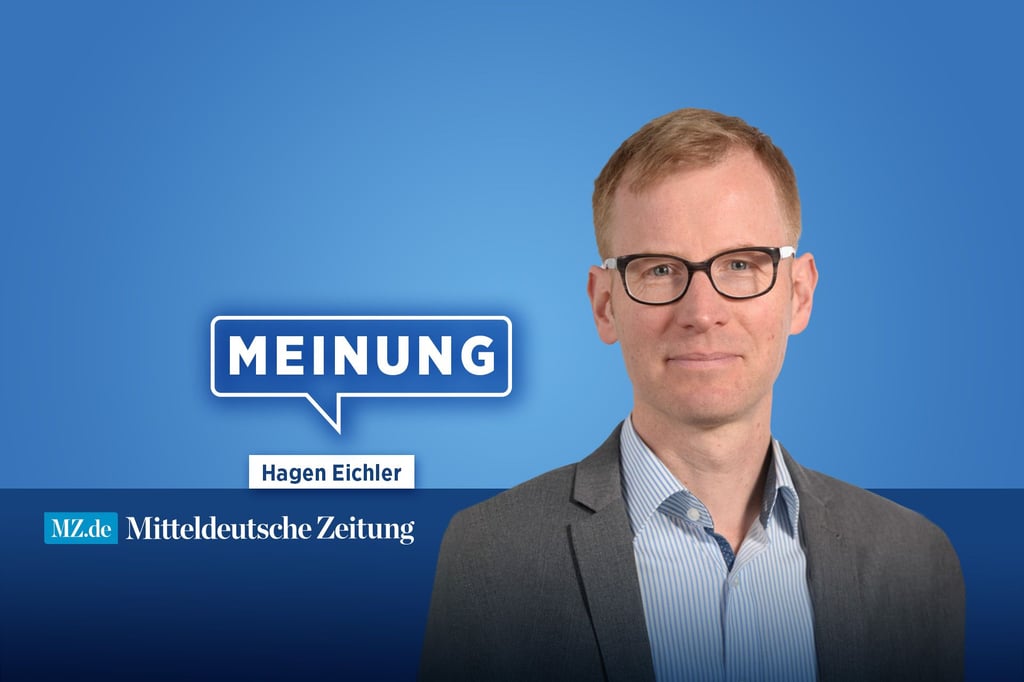Wendeherbst 1989 in Leipzig Wendeherbst 1989 in Leipzig: Die Abweichler und die Angst vor einem Blutbad

Leipzig - Im Herbst 1989 ist Roland Wötzel der Glaube ans System abhanden gekommen. Montag, 9. Oktober 1989, Leipzig. Vormittags sitzt Wötzel in einer Parteisitzung. Nachmittags trifft er sich mit Kurt Masur und anderen Leipziger Persönlichkeiten. In den Stunden danach wird Roland Wötzel, SED-Bezirkssekretär für Wissenschaft, zum Dissidenten in seiner eigenen Partei. Und, wider Willen, zu einer zeitgeschichtlichen Figur.
Maestro Masur ist in großer Sorge an diesem Oktobermontag. Der Gewandhauskapellmeister hat Angst, am Abend könne es zu einem Blutbad kommen. Wieder wollen Menschen in Leipzig demonstrieren, den sechsten Montag in Folge seit dem 4. September, als die Proteste sogar in die Tagesschau gelangten. Und der Staat macht sich bereit durchzugreifen.
Masur trommelt Wötzel und zwei weitere hohe SED-Funktionäre zusammen. Wötzel ruft den Kabarettisten Bernd-Lutz Lange dazu, der sich schon im Sommer als Vermittler zwischen den Behörden und der Opposition angeboten hat. Auch der Theologe Peter Zimmermann sitzt mit am Tisch in Masurs Haus. Gemeinsam verfassen sie einen Aufruf gegen Gewalt (siehe „Der Aufruf...“ ). Am Abend wird der Text im sogenannten Stadtfunk übertragen - fest installierte Lautsprecher, die sich überall in der Innenstadt befinden. Dort, wo die Staatsmacht den Demonstranten gegenübersteht.
„Leipziger Sechs“ um Masur gehen in die Geschichte ein
Die Autoren um den 2015 verstorbenen Masur gehen als „Leipziger Sechs“ in die Geschichte ein. Für Wötzel, der als dialogbereiter Reformer im Apparat gilt, und seine Parteigenossen Kurt Meyer und Jochen Pommert, der in diesem Juni verstarb, kommt die Arbeit an den Aufruf einer Gratwanderung gleich: Die drei hohen Funktionäre stellen sich damit gegen die Parteilinie.
Bei Experten findet das heute noch Anerkennung: „Natürlich waren sie Vertreter einer Diktatur, aber man muss ihnen dennoch zugutehalten, dass sie die drohende Gefahr am 9. Oktober erkannt haben und aus der Parteidisziplin ausgeschert sind“, hat der Leipziger Historiker Sascha Lange, Sohn von Bernd-Lutz Lange, jetzt der Leipziger Volkszeitung gesagt. Das verdiene Respekt, so Lange, diesen Mut habe bis dahin niemand in der SED aufgebracht.
Montagsdemos: Leipzig im Ausnahmezustand
Leipzig ist schon seit Wochen im Ausnahmezustand. Von Montag zu Montag gehen mehr Menschen auf die Straße, 70.000 werden es am 9. Oktober sein. Sie protestieren in einer Stadt, in der Soldaten Straßenbahnen steuern und Medizinstudenten im letzten Semester in die Polikliniken geschickt werden, um die Grundversorgung aufrechtzuerhalten.
Es ist der verzweifelte Versuch des Staates, diejenigen zu ersetzen, die seit dem Sommer zunehmend aus der DDR flüchten. Die Stadt blutet täglich mehr aus, wie das ganze Land.
Am 9. Oktober ist die Spannung förmlich mit Händen zu greifen. „Wer mit offenen Augen durch die Stadt gegangen ist, hat gesehen, dass sich da etwas zusammenbraut“, erinnert sich Hans-Joachim Kollath. Der damalige Direktor für „Absatz und Außenwirtschaft“ des Fernseh- und Rundfunkkombinates Staßfurt ist seinerzeit gerade zu Besuch in Leipzig, die Binnenhandelsmesse hat ihn hergeführt. Ihn begleiten rund 40 Abgesandte mehrerer Kombinatsbetriebe aus der gesamten DDR.
Wende 89: Niemand konnte wissen, ob es friedlich bleibt
Kollath fühlt sich für sie verantwortlich, er hat kein gutes Gefühl. „Wir waren im Handelshof mitten in der Stadt“, erzählt er. „Wir haben gesehen, wie in den Nebenstraßen Rotkreuz-Zelte aufgebaut und Kampfgruppen zusammengezogen wurden.“ Am Vormittag beschließt Kollath, seine Leute nach Hause zu schicken. Sicher ist sicher. Zur gleichen Zeit werden in den Betrieben die Belegschaften, in den Schulen die Schüler aufgefordert, nachmittags die Innenstadt zu meiden. Die Krankenhäuser, so geht das Gerücht, stocken ihre Blutkonserven auf.
Niemand kann ahnen, dass der Abend friedlich bleibt. Neben Aufrufen zur Gewaltlosigkeit von Oppositionsgruppen wie dem Neuen Forum hat auch der Appell der „Leipziger Sechs“ seinen Anteil daran. Mehr noch: Roland Wötzel, Kurt Meyer und Jochen Pommert, die drei SED-Funktionäre, fordern den Einsatzleiter, ihren Vorgesetzten, sogar auf, die bewaffneten Kräfte zurückzuziehen.
„Bürger!
Professor Kurt Masur, Pfarrer Dr. Zimmermann, der Kabarettist Bernd-Lutz Lange und die Sekretäre der SED-Bezirksleitung Dr. Kurt Meyer, Jochen Pommert und Dr. Roland Wötzel wenden sich mit folgendem Aufruf an alle Leipziger:
Unsere gemeinsame Sorge und Verantwortung haben uns heute zusammengeführt. Wir sind von der Entwicklung in unserer Stadt betroffen und suchen nach einer Lösung. Wir alle brauchen freien Meinungsaustausch über die Weiterführung des Sozialismus in unserem Land.
Deshalb versprechen die Genannten heute allen Bürgern, ihre ganze Kraft und Autorität dafür einzusetzen, dass dieser Dialog nicht nur im Bezirk Leipzig, sondern auch mit unserer Regierung geführt wird. Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird.“
Denn Waffen gegen die eigene Bevölkerung - „das konnte nicht richtig sein“, so hat Wötzel es in einem Zeitzeugen-Interview für das „Haus der Geschichte“ ausgedrückt. Da sei sein Weltbild verloren gegangen. Das Weltbild eines Mannes, der, wie er sagt, als junger Mensch sein Ideal im „Kommunistischen Manifest“ gefunden hat. Der aber auch feststellt, dass sich die SED mit ihrer Politik Ende der 1980er Jahre mehr und mehr vom Volk gelöst habe.
Und gegen dieses Volk soll der Staat sich nun mit Gewalt wenden? Wötzel will das nicht zulassen. Doch der Kommandant an diesem Abend, der amtierende SED-Bezirkschef Helmut Hackenberg, zögert. Er will sich erst in Berlin rückversichern. Die Genossen in der Hauptstadt sollen ihm sagen, was zu tun ist.
Die Genossen schweigen
Doch die Genossen schweigen. Erich Honecker ist nicht greifbar. Sein Stellvertreter Egon Krenz verspricht zurückzurufen, meldet sich aber lange nicht. Als er es tut, ist es zu spät: Hackenberg hat bereits den Rückzug befohlen.
Der Demonstrationszug ist noch 200 Meter vom Hauptbahnhof entfernt, wo er, so der Plan, mit Gewalt gestoppt werden soll, da kapituliert die Staatsmacht. 70.000 Demonstranten haben gewonnen. „Gegen die friedliche Revolution des Volkes hatten wir kein Konzept“, wird ein Stasi-Major später einräumen.
Experten sind sich heute einig, dass der 9. Oktober in Leipzig der „Tag der Entscheidung“ war, wie es der Leiter des Leipziger Stasimuseums, Tobias Hollitzer, mal formuliert hat. Danach geht alles ganz schnell: Nur neun Tage später tritt Honecker zurück, Krenz wird sein Nachfolger. Am 4. November ernennt die SED Roland Wötzel zum neuen Leipziger Bezirkschef. Fünf Tage später fällt die Mauer. (mz)
››Diskussion zum Aufruf der „Leipziger Sechs“ mit Bernd-Lutz Lange, Roland Wötzel und Kurt Meyer: 10. Oktober, 19 Uhr, Gewandhaus Leipzig