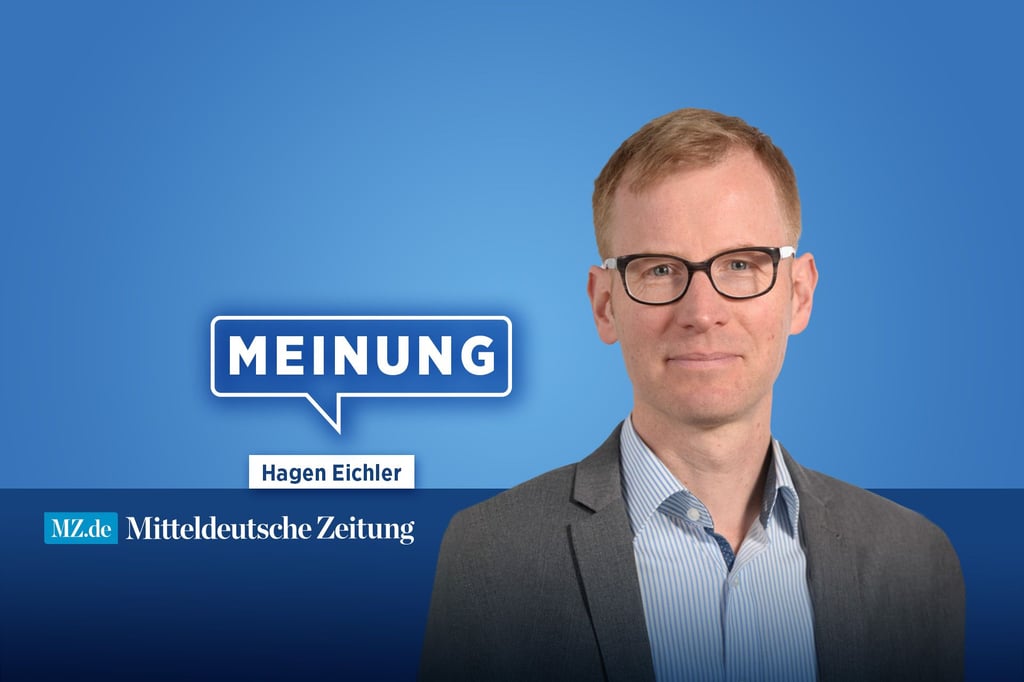Wege aus der Flaute Wege aus der Flaute: Neue Regeln sollen Ausbau der Windenergie wiederbeleben

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Koalition ringt um neue Flächen zum Bau von Windkraftanlagen. So soll der beinahe zum Erliegen gekommene Ausbau der Rotoren wiederbelebt werden, um die Energiewende zu schaffen. Jetzt liegen zwei Vorschläge auf dem Tisch, um trotz strenger Bauregeln neue Flächen für Windanlagen zu erschließen:
Die Grünen wollen geltende Abstandsregeln lockern, die für Neubauten im Umkreis von Gewerbe-, Wohn-, und anderen schützenswerten Gebieten gelten. Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) will zudem stillgelegte Tagebaugebiete nutzen, um dort Windparks zu errichten. Mit der CDU bremst allerdings der dritte Koalitionspartner. Er lehnt Lockerungen der Abstandsregeln ab.
Hintergrund der Debatte ist der eingebrochene Ausbau der Windenergie in Sachsen-Anhalt, aber auch bundesweit. Nur 14 neue Anlagen wurden 2019 hierzulande gebaut, der niedrigste Wert seit dem Jahr 2000. Noch 2015 waren es 99 neue Windräder. Dabei macht der absehbare Kohleausstieg die Umstellung auf erneuerbare Energien notwendig.
Windkraft weiterhin wichtigste Quelle für sauberen Strom
Die wichtigeste Quelle für sauberen Strom ist weiterhin die Windkraft. Mit Blick auf den Markteinbruch - 2017 fielen in der Branche bundesweit rund 26.000 Stellen weg - warnte der Grünen-Abgeordnete Olaf Meister am Donnerstag im Landtag: „Das ist keine Schwankung der Marktlage, das ist letztlich politisch verursacht.“
Aus Sicht der Grünen fehlen in Sachsen-Anhalt ausgewiesene Flächen zum Bau neuer Anlagen. Etwa ein Prozent des Landes ist bebaut, zwei Prozent sollen es aus Sicht der Grünen sein. Meister plädiert deshalb dafür, bestehende, starre Abstandsregeln im Einzelfall lockern zu können.
So soll es künftig den Kommunen obliegen, ob sie Windparks oder Anlagen näher als bisher an Siedlungen, Gewerbegebiete oder andere Areale bauen lassen wollen. Bisher gelten dafür feste Regeln im Land, sie werden von den sogenannten Planungsgemeinschaften festgelegt. Im Harz etwa sind momentan 1.000 Meter Abstand zu Wohngebieten vorgeschrieben, für Kur- und Klinikgebiete sind es 1.300 Meter. „Das sollte aber im Einzelfall gelockert werden können“, sagte Meister. Das könne vom Land geregelt werden.
„Repowering“: Alte Anlagen durch leistungsstärkere Windräder erstzen
Der Grünen-Abgeordnete hat dafür die Unterstützung zweier Regierungsmitglieder. Neben Energieministerin und Parteifreundin Claudia Dalbert ist auch Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) auf seiner Seite. Der Minister sagte, der Diskussion über „größere Variabilität bei Abstandsflächen sollten wir uns nicht verschließen“.
Und: „Dort, wo wir noch Tagebaulöcher haben, können wir durchaus über neue Windkraftanlagen sprechen.“ Bisher ist das in alten Tagebaugebieten nicht möglich. Einig ist sich die Koalition, dass die Gesamtzahl der 2.900 Windräder nicht steigen muss - im Zuge des „Repowering“ sollen aber alte Anlagen gegen neue, leistungsfähigere und meist größere Windräder ausgetauscht werden.
Vogelschutz, Lärm, Schattenwurf: Viele Klagen gegen Windräder
Brisanz liegt in den Vorstößen, da es regelmäßig zu Klagen gegen geplante Windräder kommt. Das ist ein zentraler Grund für die Probleme der Branche. Seit 2006 verzeichnet das Umweltministerium etwa 50 Klagen gegen Projekte - teils ging es um Vogelschutz, teils um Lärm oder Schattenwurf. In den Kommunen gibt es viel Skepsis, wenn es um neue Bauflächen für Anlagen geht.
Entsprechend warnt die CDU davor, Abstandsregeln zu lockern. Wirtschaftspolitiker Ulrich Thomas kritisierte, zu oft seien „die Leute nicht gefragt worden, ob sie ein Windrad vor ihrer Haustür haben wollen“. Zudem profitierten Gemeinden zu wenig von den Anlagen: Steuern flössen in westdeutsche Bundesländer, wo zahlreiche Betreiber ihren Sitz haben. (mz)