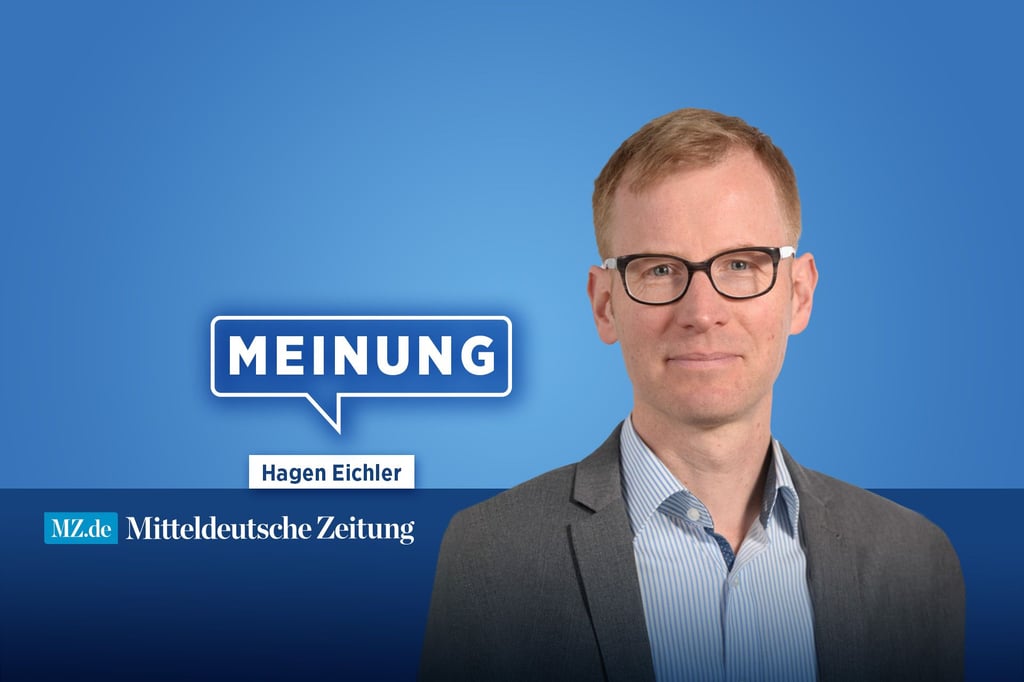Jüdische Gemeinde Synagogenbau in Dessau - Der Spender mit den leeren Taschen
Der Dessauer Olaf Wendel war schon Holzfäller, Sozialarbeiter, Galerist und Staatsfeind. Als er hörte, dass die Jüdische Gemeinde seiner Stadt ihre Synagoge neu errichten will, überlegte er nicht lange und startete einen Dauerauftrag.

Dessau/MZ. - Von Steffen KönauEs gibt keine persönliche Verbindung, kein dunkles Familiengeheimnis, keine verdrängte Schuld früherer Generationen. Olaf Wendel schüttelt ganz entschieden den Kopf. Um eine Ablasszahlung sei es bei seiner Dauerspende für den Bau einer neuen Synagoge in Dessau nicht gegangen, schüttelt er demonstrativ den Kopf. Und nein, auch nicht darum, sich symbolisch ein gutes Gewissen kaufen zu wollen.
Berührt vom Grauen
„Mich hat die Geschichte des jüdischen Volkes schon berührt, als wir die Naziverbrechen in der Schule durchgenommen haben“, sagt der Mann mit dem Zauselbart. Das unvorstellbare Grauen, dieser ungeheuerliche Plan, ein ganzes Volk auslöschen zu wollen, eine Kultur auszuradieren. „Das hat mich getroffen.“

Und nie mehr losgelassen. Wendel hat gelesen, die Bücher des jüdischen Nobelpreisträgers Isaac Bashevis Singer vor allem. „Er entkam den Nazis und beschreibt die Vernichtung des polnischen Judentums eindringlich.“ Eine Auslöschung, deren Spuren Olaf Wendel auch in seiner eigenen Stadt Dessau ein Leben lang begegnete. Wie eine Wunde wirkt der leere Raum, wo die Kantorstraße auf die Askanische Straße stößt.
Bis zum 9. November 1938 hatte hier die 1908 fertiggestellte Synagoge der Jüdischen Gemeinde Dessaus gestanden, das größte jüdische Gotteshaus der Stadt. Bei den Novemberpogromen wurde der Bau geplündert, verwüstet und in Brand gesteckt. Die Behörden verfügten wenig später den Abriss, den die jüdische Gemeinde bezahlen musste.
Olaf Wendel ist Dessauer nicht nur von Geburt, sondern mit Herz und Leidenschaft. Schon zu DDR-Zeiten, sagt er, habe er aber auch Halle gemocht, nachdem er sich die Stadt am Rande von Ausflügen zu Fußballspielen des HFC erschlossen hatte. „Aber als sie mich kurz vor dem letzten ,Tag der Republik’ abgeholt haben, drei Stasi-Leute früh um sechs, die kein Wort der Erklärung abgegeben haben, war meine größte Sorge, dass die mich ausbürgern, einfach über die Grenze in den Westen.“
Dass der Stasi-Transporter von der Autobahn Richtung Halle abfährt und Wendel schließlich in einer Zelle des berüchtigten Gefängnisses Roter Ochse landet, hat den heute 58-Jährigen damals richtiggehend erleichtert. „Als mir das klar wurde, war ich sofort wieder obenauf.“
In Haft besinnt sich Olaf Wendel auf die Strategie, die er mit Freunden ausgedacht hat. „Ich wusste natürlich, das die mich geholt hatten, weil wir bei mir in der Wohnung das Dessauer Neue Forum gegründet haben.“ Doch im Verhör stellt er sich dumm. „Ich habe gesagt, dass ich die meiste Zeit in der Küche war, um Tee für die vielen Leute zu kochen.“ Die habe er meist gar nicht gekannt. „Und deshalb hätte ich auch nicht mitgekommen, was genau besprochen wurde.“
Wendel nennt sich selbst nicht einen Oppositionellen, sondern einen Opponierenden. Aufgewachsen als Sohn eines Volkspolizisten, ist ihm die DDR zu eng, die Staatsgläubigkeit zu groß, das Hereinreden ins eigene Leben zu intensiv und drängend. „Mein Vater ging zu diesen Parteilehrjahren, meine Mutter sah das zwar lockerer, aber man sucht seinen eigenen Weg als junger Mensch.“
Wendel hat lange gesucht und lange vergeblich. Nach einer Lehre, bei der ihm der Facharbeiterbrief wegen seiner Aufmüpfigkeit verwehrt wird, landet er in der Forstwirtschaft. Danach arbeitet er als Nachtwächter in der Stadtmission, als Platzanweiser im Kino und als Friedhofsgärtner. „Es war das Leben eines Bohemien“, sagt er, „ich wollte nur so viel Geld verdienen, dass ich über die Runden komme, ohne diesen Staat zu stützen.“
Aufbruch in eine neue Zeit
Seine eigene Stütze ist der große Freundeskreis aus Gleichgesinnten. „Wir waren kulturinteressiert und kritisch, wir haben unsere eigenen Events veranstaltet, gelesen, Musik gehört und diskutiert.“ Olaf Wendel hat diese Zeit nie vergessen, und selbst in der Erinnerung genießt er sie noch. „Ich hatte damals zum christlichen Glauben gefunden und viel Bonhoeffer gelesen, dessen innere Unbedingtheit mir imponiert hat.“
Tun, was man für richtig hält. Festhalten an Grundüberzeugungen, auch wenn der Wind einem ins Gesicht weht. Olaf Wendel versucht schon in den Tagen des Umbruchs in der DDR, ernst damit zu machen. Er kündigt seinen Job in der Friedhofsgärtnerei, „um diesen großen Neuanfang wirklich mitzugestalten“. Er engagiert sich in der Jugendarbeit, wird Stadtrat und Sozialarbeiter in einem Jugendprojekt, betreut Hausbesetzer und Punks, organisiert Demos gegen rechts und versucht sich als Pressesprecher für die Bürgerbewegung Neues Forum. „Ich habe aber schnell eingesehen, dass ich dazu viel zu poetisch bin“, sagt er mit einem Lächeln.
Olaf Wendel hat seitdem einige Rechnungen bezahlen müssen. Unzufrieden mit der Lethargie, die sich in der Jugendarbeit breit machte, versuchte er einen Neuanfang als Galerist. Mit bitterem Ende: „Es lief von Anfang an nicht gut, aber dann immer schlechter“, erzählt er, „nur habe ich nicht glauben wollen, dass es einfach nicht funktioniert.“ Vor allem mit seinem langen Zögern vor dem unausweichlichen Schritt, das Kapitel zu beenden, hadert Wendel. „Das hat mich tief in die roten Zahlen gedrückt, und an den Schulden zahle ich bis heute zurück, Euro für Euro.“
Ein ganz kleiner Beitrag
Finanziell ist der Vater zweier Töchter bis heute nicht auf Rosen gebettet. „Ich betreibe ein Antiquariat im Internet, um ein wenig zum Familieneinkommen beizutragen“, sagt er. Dass er geben wird, was möglich ist, steht für ihn dennoch sofort fest, als er zum ersten Mal von Plänen der Jüdischen Gemeinde in Dessau hört, einen Ersatzbau für die in der Nazi-Zeit zerstörte Synagoge zu errichten. Sieben Euro im Monat, das steht unterm Strich, lassen sich abknapsen.
„Natürlich glaube ich nicht, dass mein winziger Beitrag irgendeine Rolle spielt.“ Die Kosten des Baus liegen bei 4,8 Millionen Euro. Aufgebracht wurde die Summe von der Gemeinde, Stadt, Land, Bund und Reemtsma-Stiftung. Aber das sei eben, was er regelmäßig überweisen konnte, seit die Baupläne konkret wurden. „Würden alle Dessauer mitmachen, wäre alles fast finanziert.“
Darum aber geht es nicht, das ist auch Alexander Wassermann klar. Die Liste der privaten Spender, die regelmäßig Beträge per Dauerauftrag überwiesen haben, sei kurz, sagt der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Dessau. Doch die Gemeinde sei umso dankbarer für die, die ihre Solidarität mit den Juden ihrer Stadt auf diese Art ausdrücken.
Olaf Wendel wird seinen Dauerauftrag weiterlaufen lassen. Zusammen mit Freunden wolle er demnächst Kontakt zur Gemeinde aufnehmen, um gemeinsame Projekte anzuschieben. „Gerade nach dem Angriff der Hamas auf Israel, den Morden an Juden, dem Erstarken des Antisemitismus und dem Zuspruch, den sich eine rechtsextreme Partei erfreut, müssen wir wieder aus dem Trott herauskommen, die Dinge einfach geschehen zu lassen.“