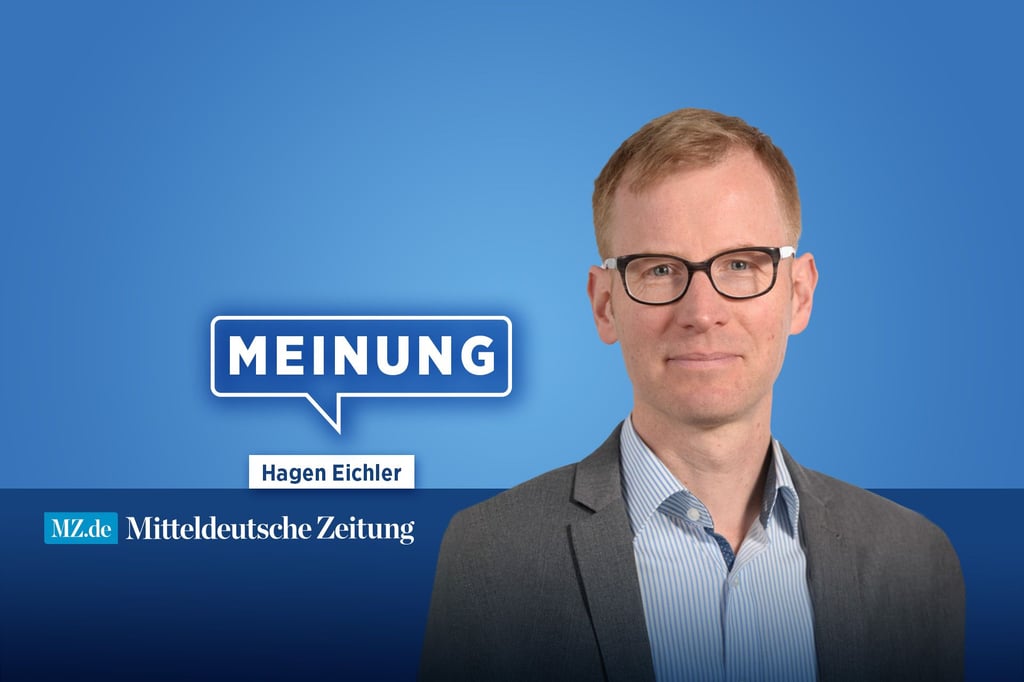Wissenschaft Dem Coronavirus auf der Spur: So wollen Forscher aus Halle Veranstaltungen sicherer machen
Die Kulturbranche hat in der Pandemie gelitten. Dabei sind Konzerte, Theater und Kino auch in solchen Zeiten möglich, sagen Experten der Universitätsmedizin. Wie genau, das haben sie jetzt mit einem ungewöhnlichen Versuch in der Oper der Saalestadt untersucht.

Dass es kein normaler Abend wird, ist schon auf den ersten Blick klar: 100 schwarze Eimer und eine Handvoll Plastikpuppen besetzen einen Teil der roten Sessel in der Oper Halle, ein Generator brummt am Rand des Saals leise vor sich hin – und zwischen den Reihen bläst ein Gerät deutlich sichtbar weißen Dampf in die Luft. Das ist in diesem Fall bloß ein Verteiler mit einer Lösung aus Kochsalz und Wasser. Hier könnte aber genauso gut ein Mensch sitzen, der mit Corona infiziert ist und eine mit Viren versetzte Wolke aus Aerosolen in die Luft atmet. Diese kleinen Schwebeteilchen bergen die Gefahr, die Erkrankung auf andere Besucher zu übertragen.

„Wir wollen sehen, wie genau sich die Aerosole verteilen“, sagt Dr. Stefan Moritz, während er den Probelauf für die Messung begutachtet. Der Arzt leitet die Klinische Infektiologie am Universitätsklinikum Halle – und die Studie „Restart 2.0“. Seit einem halben Jahr sammelt ein Team der Unimedizin mit Technischer Universität Berlin und Berliner Charité dafür Daten von Veranstaltungen im Innenbereich. Ziel sei es, ein Bewertungskonzept für Räumlichkeiten wie Konzerthallen oder Kinos hinsichtlich des Ansteckungsrisikos zu entwickeln, erklärt Moritz. Das soll Veranstaltern zeigen, wie gut ihre Säle diesbezüglich sind - und wie sie verbessert werden könnten, etwa durch neue Lüftungstechnik. Außerdem soll die Studie die Basis dafür sein, künftig bei der Raumgestaltung den Infektionsschutz quasi gleich mitplanen zu können.
Messungen für Restart 2.0 in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Berlin
Bei der Datensammlung ist das Team um Moritz auf der Zielgeraden. Die Messung in Halle ist die vorletzte von zehn in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Berlin. Ganz unterschiedliche Räume haben die Wissenschaftler unter die Lupe genommen: vom fast schon intimen Lokal bis zur Handball-Arena in Leipzig. Oder eben eine Oper, in der ein Uni-Kinoabend mit dem Film „Bohemian Rhapsody“ stattfindet. Nach und nach strömen die Besucher in den Saal, neugierige Blicke fallen auf die Versuchsgeräte. 674 Menschen würden hier Platz finden. 215 Menschen - inklusive der Wissenschaftler - sind es unter 2-G-Plus-Bedingungen mit Maskenpflicht an diesem Abend. Und die 100 Eimer, die auf knapp 40 Grad beheizt sind und je eine Person simulieren.

Oder besser gesagt: die Wärme, die ein Körper abgibt. Rund 80 Watt sind das - was insgesamt für reichlich Auftrieb sorgt und den Strom der Aerosole beeinflussen kann. „Wir haben einen Verteiler im Saal und insgesamt sieben Empfänger“, sagt Isabell Schulz und deutet auf durchsichtige Plastikkisten, aus denen offene Enden von Schläuchen ragen. Mit diesen Messstationen - bisweilen auch als Menschenpuppen gestaltet - könne man die Kochsalzkonzentration in der Luft erfassen, erläutert die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Charité. Damit seien Rückschlüsse auf eine mögliche Infektionsgefahr möglich, wie Stefan Moritz ergänzt: „In Wasser gelöstes Kochsalz verhält sich ähnlich wie virusbeladene Aerosole.“

Wie hoch das Risiko einer Ansteckung ist, hänge stark von der Art der Lüftung ab, sagt der Mediziner. Per Computersimulation haben die Forscher ermittelt, dass zwischen einer guten und einer schlechten Lüftungsvariante im selben Raum Welten liegen können: in Zahlen zwischen acht und 100 potenziellen Ansteckungen durch einen einzigen Infizierten. Das Zwischenfazit: „Eine Quelllüftung aus dem Boden ist wohl generell besser geeignet“, sagt Moritz. Aber genau werde man dies und vieles andere erst einordnen können, wenn alle Auswertungen gemacht sind. Bis zum Sommer will das Team die Studie fertigstellen. Dann soll sie dem Umweltbundesamt, das für den Infektionsschutz zuständig ist, übergeben werden.
Die nächste Pandemie droht - Gefahr durch Influenza möglich
Die letzten Kinogänger nehmen Platz, während ein Mitarbeiter mit Stefan Moritz auf dem Laptop noch einmal die anstehende Messung durchgeht. Das Team kann live verfolgen, wie sich die Kochsalzkonzentration in den Messboxen entwickelt - sprich: wie die Aerosole umherschweben würden, im Ernstfall. Mit diesem werden wir uns alle wohl noch länger auseinandersetzen müssen, lautet die Einschätzung des Infektiologen. „Das Coronavirus wird uns erhalten bleiben, in welcher Form auch immer“, sagt er. Und das ist sicher: Die nächste Pandemie kommt bestimmt.“ Womöglich mit einem Influenza-Virus. Auch dann seien die Erkenntnisse der Studie wichtig, so Moritz. Vor allem, wenn man als Ziel sehe, wieder eine Vollauslastung bei Veranstaltungen zu erreichen.
Kurz darauf steigt er auf die Bühne und erklärt, warum solch seltsame Aufbauten im Saal zu sehen sind. Dann erlischt das Licht, der Generator brummt wieder - und weißer Dampf steigt auf.