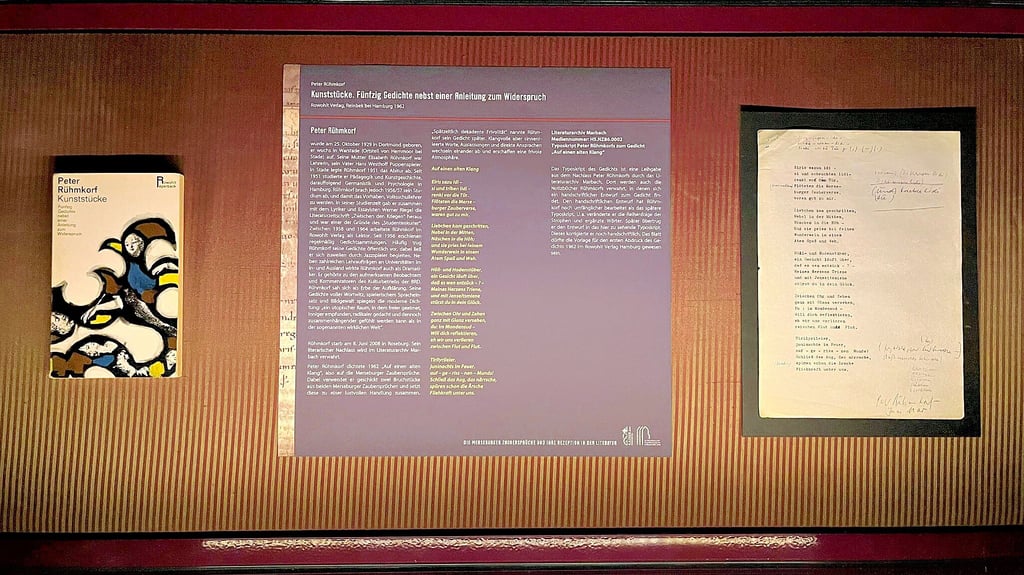Mehr Platz für Visionen Mehr Platz für Visionen in Schkopau: Fraunhofer erweitert für Autos der Zukunft

Schkopau - Die Automobile der Zukunft haben zu einem großen Teil ihre Wiege in Schkopau. Zumindest werden die Forscher des Fraunhofer-Instituts im dortigen Industriepark auch in den kommenden Jahren unter besten Bedingungen daran forschen können, wie sich Fahrzeuge deutlich leichter konstruieren lassen. Denn weniger Gewicht bedeutet letztlich auch einen geringeren Treibstoff- oder Energieverbrauch.
Am Donnerstag erfolgte am seit 2005 bestehenden Pilotanlagenzentrum Fraunhofers der Spatenstich für eine 15 Millionen Euro teure Erweiterung. In dem neuen Komplex soll dann beispielsweise auch die Produktion von Reifen dank der Wissenschaftler optimiert werden, wie es hieß.
Fraunhofer in Schkopau: Mehr Kunststoff im Auto
Bereits seit mehr als zehn Jahren entstehen in Schkopau praktisch Autoteile in Leichtbauweise aus dem Labor. Dort, wo bislang metallische Bauteile ihren Platz finden, sollen mehr und mehr Polymerkonstruktionen verwendet werden. Der Kunststoffanteil an Fahrzeugen könnte dank der Forschung von derzeit rund einem Prozent auf zehn bis 15 Prozent steigen, so die Hoffnung der Tüftler aus Schkopau.
Damit die Kunststoffteile die gleichen Eigenschaften, insbesondere natürlich eine vergleichbare Stabilität aufweisen, leisten die Schkopauer Vorarbeiten im Nanobereich. So werden Polymerfasern in einem ersten Schritt so ausgerichtet, dass sie alle in eine Richtung zeigen. „Indem wir die Fasern nach Wunsch ausrichten, können speziell gewünschte Anforderungen an bestimmte Bauteile berücksichtigt werden“, erklärt Michael Kraft, Sprecher des Fraunhofer-Instituts für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen (IMWS) in Halle, das im Verbund mit einem weiteren Institut der Fraunhofer-Gesellschaft in Potsdam das Pilotanlagenzentrum in Schkopau betreibt. Mit Spritzgussmaschinen werden letztlich die gewünschten Bauteile gefertigt.
Polymerverarbeitung: „Autoteile, Fahrräder, Helme, Maschinen“
Das Pilotanlagenzentrum spiele dabei eine entscheidende Rolle, weil es dank ihm gelungen ist, im großen Maßstab zu arbeiten. „Viele Innovationen sind nämlich daran gescheitert, dass es nicht gelungen ist, Ergebnisse aus dem Labor auf Großanlagen zu übertragen“, erklärt Michael Kraft die Bedeutung der Einrichtung.
Sowohl im eigenen Interesse als auch in Zusammenarbeit mit der Industrie werden neue Verfahren nun seit Jahren erprobt. „Autoteile, Fahrräder, Helme, Maschinen“, nennt der Leiter der Polymerverarbeitung, Peter Michel, mögliche Anwendungen der neu gesammelten Erkenntnisse. Mit der Erweiterung, die laut Plan Anfang 2020 den Betrieb aufnehmen soll, kommen auf einer zusätzlichen Fläche von rund 1.000 Quadratmetern weitere Forschungsbereiche hinzu.
Forschung und Digitalisierung: Bauteile lernen sprechen
So wollen die Wissenschaftler künftig auch versuchen, den perfekten Reifen zu konstruieren. Zudem rücke die Digitalisierung mehr und mehr in den Fokus. „Dank einer Anwendung können wir bereits bestimmte Eigenschaften definieren, die ein Reifen haben soll“, sagt Michel. Die App macht dann automatisch Vorschläge zur idealen Rezeptur.
Generell messen die Forscher der Digitalisierung eine enorme Bedeutung bei. „Prozesse können sich dank der digitalen Möglichkeiten in Zukunft viel effizienter gestalten“, meint IMWS-Sprecher Michael Kraft. Über Sensoren, die Bauteile erhalten, könnten künftig alle möglichen Informationen zu Rohstoffen, Produktionsort und Zustand verfügbar gemacht werden. Die Teile lernen quasi sprechen. „Bei einem Verschleißteil könnte man etwa erfahren, wann es ausgetauscht werden muss“, erklärt Kraft ein weiteres Anwendungsbeispiel. Das unflexible Abwarten von Wartungsintervallen wäre hinfällig. Und auch mit Blick auf die Nachhaltigkeit seien solche Infos nützlich. Wenn man weiß, was alles in einem Bauteil steckt, dann könne man es besser recyceln. (mz)