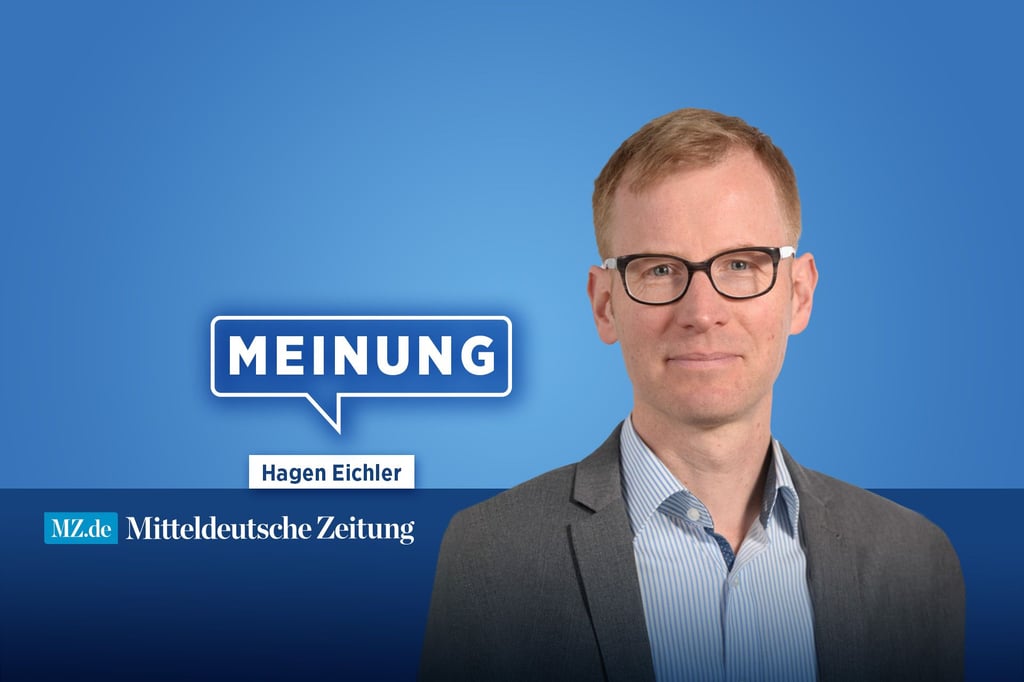Markenschutz Markenschutz: Schlesischer Streuselkuchen beschäftigt EU-Gericht

Görlitz/Berlin/dpa - Wenn von Schlesischem Streuselkuchen die Rede ist, vergeht Bäckermeister Michael Tschirch der Appetit. Seit der Begriff rechtlich umstritten ist - und das grenzüberschreitend -, scheut sich der Görlitzer Handwerker, sein traditionelles Backwerk unter diesem Namen zu verkaufen. Der Name ist als geographische Angabe geschützt worden, allerdings nur für jenen Teil Schlesiens, der in Polen liegt. So steht es in einer EU-Verordnung. Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks hat eine Klage dagegen in Brüssel eingereicht. Wann in der Sache entschieden wird, ist ungewiss.
Wo genau ist Schlesien?
Ende 2011 hatte der Verband deutscher Bäcker einen Hinweis erhalten, dass sowohl „Kolocz slaski“ als auch „Kolacz slaski“ ins EU-Register der geschützten geografischen Angaben eingetragen sind. In dem offiziellen Dokument wurden diese Begriffe mit „Schlesischer Streuselkuchen“ übersetzt. Nach Zeitungsberichten hatte ein Konsortium polnischer Bäcker den Markenschutz beantragt. Er gilt nun für ein Gebiet, das auf die Woiwodschaft Opole (Oppeln) und Teile der Woiwodschaft Schlesien mit Katowice (Kattowitz) als Hauptstadt begrenzt ist.
Historisch gesehen reicht Schlesien jedoch viel weiter. Die gleichnamige preußische Provinz erstreckte sich vor der Neuordnung nach dem Zweiten Weltkrieg in west-östlicher Ausdehnung von Hoyerswerda bis Kattowitz, erklärt der Direktor des Schlesischen Museums in Görlitz, Markus Bauer. Zum überwiegenden Teil liegt das Gebiet mittlerweile in Polen; bis auf den Nordosten des heutigen Freistaates Sachsen. Genau dort, zwischen Görlitz und Weißwasser, sind die 22 Betriebe der Niederschlesischen Bäckerinnung ansässig.
"Butterdrückstreusel" statt "Schlesischer Streuselkuchen"
Ihr Obermeister Michael Tschirch hat gleich mehrere Backwaren im Sortiment, die typisch für die Region sind. Dazu zählen Schlesischer Mohnkuchen oder Liegnitzer Bomben, eine Spezialität, die ihren Ursprung in der heute polnischen Stadt Legnica haben soll. Seinen „Butterdrückstreusel“ verkauft er vorerst ohne den Zusatz „Schlesisch“. „Wir wissen nicht, was falsch ist“, gesteht Tschirch.
„Wir müssen unseren Mitgliedsbetrieben einen sicheren Weg weisen“, sagt Peter Becker, Präsident des Zentralverbandes in Berlin. Dieser will deutsche Bäcker vor wettbewerbsrechtlichen Konsequenzen schützen. Immerhin verkaufen Betriebe im gesamten Bundesgebiet Streuselkuchen nach traditioneller schlesischer Rezeptur. Dem Antrag, den Eintrag aus Polen zu löschen, erteilte die Europäische Kommission eine Absage. Daraufhin schaltete der Verband in diesem Sommer das EU-Gericht ein. „Unsere Klage richtet sich nicht gegen die polnischen Handwerker“, beteuert Becker. Vielmehr gehe es darum, Ungereimtheiten in dem Fall zu klären.
Übersetzungsfehler im EU-Amtsblatt
Möglicherweise enthält die deutsche Fassung des EU-Amtsblatts nämlich mehrere Übersetzungsfehler. In der Verordnung ist die Herstellung von „Kolacz slaski“ umfangreich und äußerst penibel beschrieben. Es sei ein Gebäck aus Hefeteig in rechteckiger Form, mit oder ohne Füllung. Die oberste Schicht bestehe aus Streuseln, heißt es unter anderem dort.
Allerdings: „„Kolacz slaski“ kann man nicht mit „schlesischer Streuselkuchen“ übersetzen“, sagt Museumsdirektor Bauer. Es gebe im Polnischen andere Begriffe dafür, etwa „placek z posypka“ oder „ciasto z kruszonka“. Unter „Kolacz“ verstehe man in Oberschlesien ein Gebäck mit Apfel, Mohn und Streusel, was hierzulande unter dem Namen „Kolatsche“ verkauft werde.
Die ostsächsischen Bäcker wünschen sich eine rasche Klärung des Streitfalls, denn eigentlich wollen sie nur unbesorgt ihrem Handwerk nachgehen. Michael Tschirch hat schon vorgeschlagen, sich mit Kollegen in Polen an einen Tisch zu setzen und den Namensstreit zu schlichten. „Mit einem ordentlichen Dolmetscher“, sagt der Görlitzer Innungsmeister.