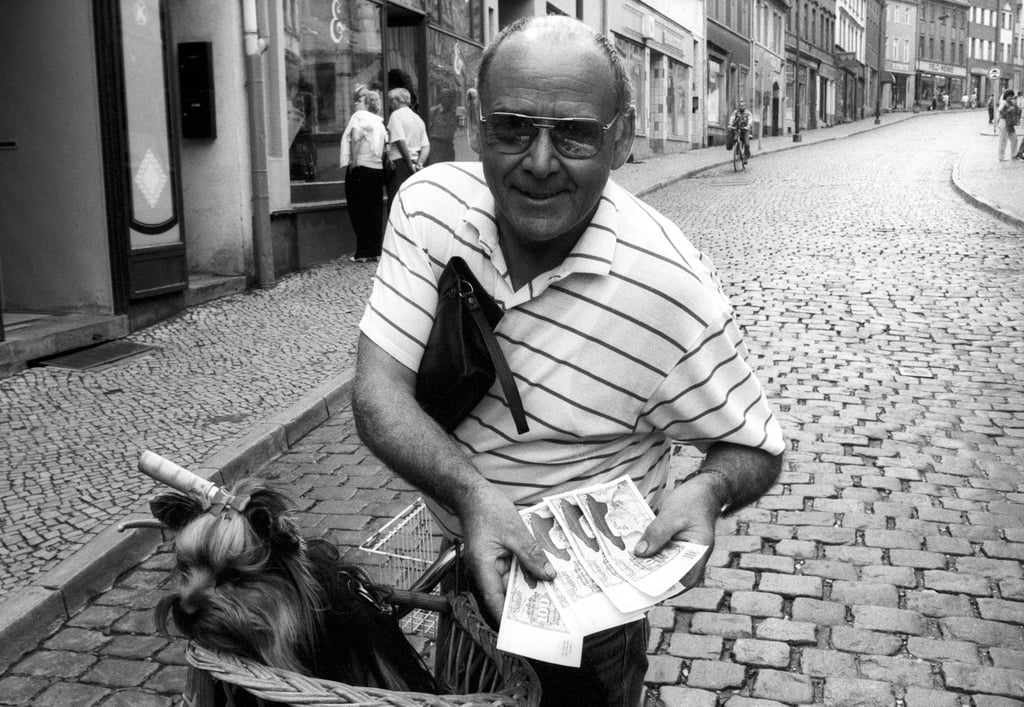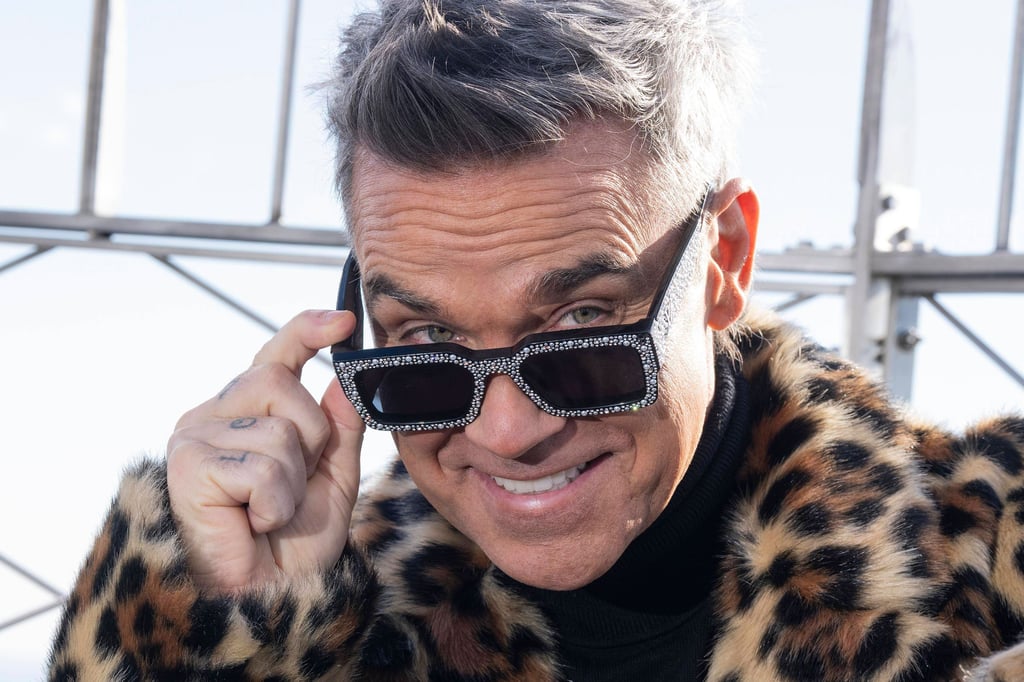Schau zeigt Musikautomaten Schau zeigt Musikautomaten: Leipzig und die "Weltwunder"-Geige

Leipzig - In dem großen quadratischen Raum des Leipziger Grassi-Museums für Musikinstrumente erklingt die Ouvertüre aus Mozarts Zauberflöte. Eine Geigenmelodie, dazu Klavierbegleitung. Aber niemand spielt - zumindest kein Mensch. Die übermannshohe und mehr als hundert Jahre alte Violina, eine Konstruktion aus Klavier und drei Geigen, musiziert allein.
Der Automat ist der Star der Ausstellung „Musik.mp0“, die von Freitag an gut 100 selbstspielende Instrumente und Musikautomaten zeigt und akustisch präsentiert. Während der Schau würden mehrere Exponate immer wieder angeworfen, verspricht Kuratorin Birgit Heise - auch die Violina, die der Volksmund einst als „achtes Weltwunder“ gefeiert habe.
„Eine selbstspielende Geige galt selbst in der Hochzeit der Musikautomaten als unmöglich“, erzählt Heise. Die Leipziger Firma Hupfeld erfand sie dennoch. Der Clou: Die Konstrukteure befestigten drei Geigen mit jeweils einer Saite nebeneinander, darum einen kreisrunden, rotierenden Geigenbogen. Wird der Motor am Fuße des Apparats angeworfen, läuft angesaugte Luft durch mehr als 100 Bleirohre.
Per Luftdruck greifen Taster die richtigen Noten; die Geige mit der benötigten Saite wird an den Bogen gedrückt; gleichzeitig bringen Hämmerchen das Klavier zum Klingen. Taktgeber ist ein unscheinbarer Papierstreifen, auf dem nebeneinanderlaufende Bahnen kleinerer und größerer Löcher die Taster koordinieren. Nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren selbstspielende Klaviere und ein Jazzklavier mit Schlagzeug, die ebenfalls im Grassi-Museum zu sehen sind.
Die Ausstellung wirft ein Licht auf ein fast vergessenes Kapitel Leipzigs als Musikstadt. „Sie war die Welthauptstadt des massenhaften Baus selbstspielender Instrumente“, berichtet die Kuratorin. Zehn Jahre lang erforschte sie die Ära von 1876 bis 1930. Zum 1000. Stadtjubiläum konzipierte die Musikwissenschaflterin die Schau und holte Exponate von Privatsammlern aus ganz Deutschland nach Leipzig.
Mehr als 100 Fabriken und Werkstätten fertigten damals Kurbelplattenspieler mit Blechplatten für den Hausgebrauch oder die imposanten selbstspielenden Instrumente für Kneipen, Hotels und Kinos in aller Welt. Es habe einen regelrechten Hype gegeben, stellt Heise fest. Jeder habe einen eigenen Plattenspieler besitzen und dank der nur wenige Pfennige teuren Blechplatten die neuesten Schlager abspielen wollen. „Heerscharen von Musikstudenten waren damit beschäftigt, beliebte Melodien für die Spiellänge von einer Minute dreißig zu arrangieren.“
Mehr passte nicht auf die Blechplatte, den gelochten Vorläufer der Schallplatte. Sie speichert jedoch nicht die akustischen Signale, sondern bewegt kleine tönende Kammzungen, wie man sie aus Spieldosen kennt. Eine Leipziger Firma habe mit dieser Technik auch die erste Jukebox erfunden, erläutert Heise. Nach dem Münzeinwurf kann aus mehreren Musikstücken gewählt werden; der Apparat zieht selbstständig die Platte und die Musik spielt - mit Motor, ohne Strom.
Doch der Siegeszug der Schallplatte und die Verbreitung des Radios machten den Leipziger Musikautomaten schließlich den Garaus. Ab 1935 brach laut Heise die Nachfrage ein, und die meisten Firmen schlossen. Von den 3000 gefertigten selbstspielenden „Weltwunder“-Geigen seien noch 60 erhalten. Eine von ihnen musiziert bis zum 31. Januar kommenden Jahres im Leipziger Museum. (dpa)