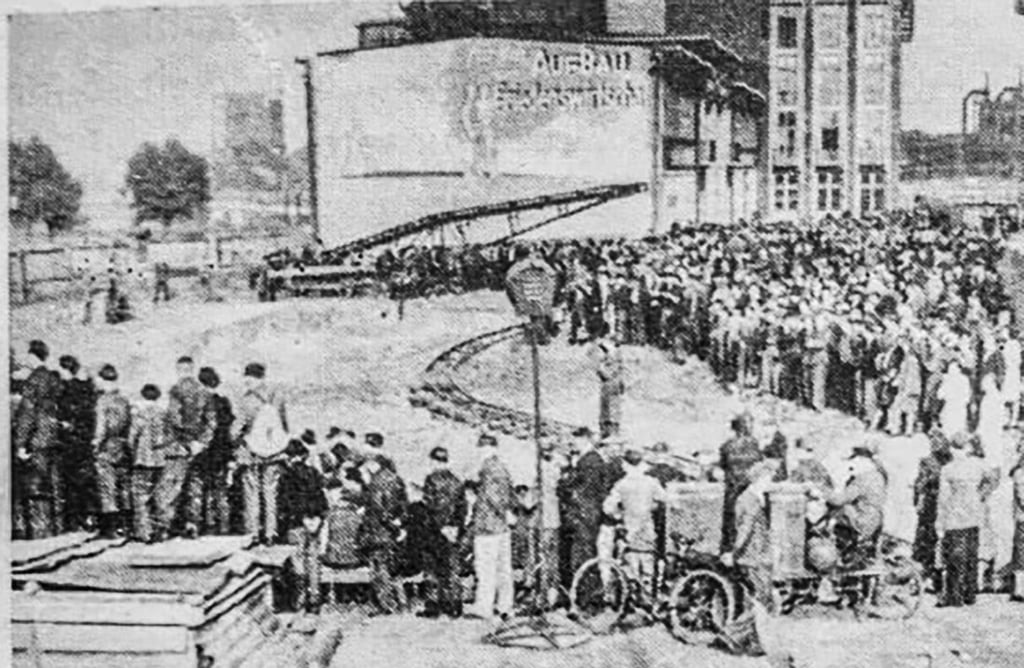Das Neubaugebiet wird noch gebraucht
Wittenberg/MZ. - Das Neubaugebiet wandelt sich - nicht nur äußerlich. Wenn alles so funktioniert, wie es sich Stadt, Stadtplaner und Wohnungsgesellschaften vorstellen, teilt sich das Viertel zwischen Lerchenberg und Schillerstraße in drei große Gebiete: Westlich der Sekundarschule stehen die Eigenheime, östlich wird altersgerecht gewohnt, Befreiung und Völkerfreundschaft bleiben ein Mischgebiet. Doch was passiert in 20 Jahren? Während die erste Phase des Stadtumbaus 2010 in Wittenberg abgeschlossen sein dürfte, setzt sich die demographische Entwicklung weiter fort. Und damit auch der weitere Umbau des Viertels - nicht nur baulich, auch sozial.
Schon jetzt, sagt Wittenbergs Quartiermanager Wolfram Wallraf, sind die Auswirkungen des Stadtumbaus Ost, deutlich zu spüren - nicht nur im Viertel. Beispiel Lindenfeld: "Was dort saniert ist, ist auch voll", sagt Wallraf und schreibt das dem Abriss im Lerchenberg zu. Denn schließlich hat der dafür gesorgt, dass sich der Wohnraum in der ganzen Stadt verknappt hat. Über 1 100 Wohnungen sind in ganz Wittenberg bereits abgerissen, bis 2008 sollen es 1 800 werden, darunter auch Häuser in Piesteritz und Apollensdorf. Viertel mit Zuwachs sind nach dem neusten Statistikbericht 2005 Altstadt, Teuchel und Apollensdorf Nord.
Doch was geschieht mit den Neubaugebieten nördlich der Hundertwasserschule, wenn sich der Bevölkerungsrückgang fortsetzt? Flächendeckend abreißen wie am Lerchenberg lässt sich da städteplanerisch kaum machen. Wer will schon ein Loch mitten in der Stadt? Eine Studie des Bauhauses in Dessau könnte den Weg zeigen. Unter dem Titel "Weniger ist mehr" haben Architekturstudenten Visionen entwickelt, was sich aus der "Platte" alles machen lässt. Maisonetten, Dachterrassen, der Garten direkt am Block. Die Visionen sind bunt, experimentell - und haben einen Haken: Schon am Lerchenberg war die Idee, Blöcke nur geschossweise abzutragen und umzugestalten, am Geld gescheitert. Der Versuch, aus Fünfgeschossern Einfamilienhäuser zu schnitzen, war zu teuer - vor allem auch wegen der Fördermodalitäten beim Abriss.
Doch Wallraf sieht noch ein anderes Problem. Die umgebauten Blöcke wären zum Beispiel etwas für junge Familien mit gutem Einkommen. Gebraucht werden in Zukunft aber eher bezahlbare Wohnungen für kleine Haushalte. "Die Zahl der Rentner, denen es nicht so gut gehen wird, wie der heutigen Rentner-Generation, wird zunehmen", schätzt Wallraf. Schon jetzt füllten sich in vielen Städten die günstigen Neubau-Wohnungen wieder.
Das Neubaugebiet der Zukunft also doch als Viertel für die finanziell Minderbemittelten, mit all den sozialen Problemen? "Einkommensschwach heißt ja nicht sozial unverträglich", sagt Wallraf. Mit marodierenden Rentnerbanden sei schließlich nicht zu rechnen. "Aber diese Viertel brauchen ein Quartiermanagement, um die Struktur zu festigen." Denn Stadtumbau hat nicht nur etwas mit Häusern zu tun, sondern auch mit den Menschen, die darin wohnen. So gesehen ist das Thema noch lange nicht erledigt: "Strukturanpassung ist im Grunde eine unendliche Geschichte", sagt Wallraf.
Mehr Informationen unter den Links.