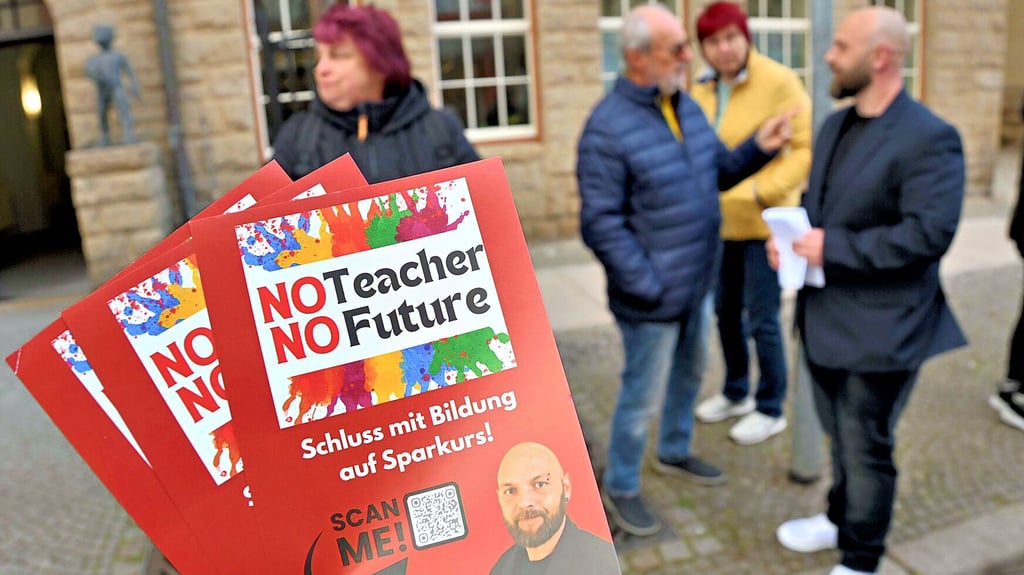Dem großen Fressen folgt das große Fällen

Gernrode/MZ. - Aufgrund der naturnahen und nachhaltig bewirtschafteten Forstflächen, auf denen selbst der wertvolle Rohstoff Holz auf eine natürliche Weise produziert wird, erfüllen die Wälder noch weitere besonders wichtige Funktionen. Der Wald dient als Erholungsraum für unzählige Menschen und filtert die Luft von Schadstoffen und verbessert die Bodenqualität, speichert Wasser und schützt vor Erosion. Für den Erhalt und die Pflege engagieren sich tagtäglich viele Menschen. Ihnen und ihrer Arbeit widmet sich der Quedlinburger Harz-Bote in einer Artikelserie
Ein kleiner Käfer treibt den Forstleuten den Schweiß auf die Stirn. Denn der bisherige Super-Sommer könnte ähnliche katastrophale Folgen haben, wie bereits im Jahr 2003. Dort hatte der Borkenkäfer sich schnell und massenhaft vermehrt und für Katastrophenalarm in den deutschen Forstämtern gesorgt. Absterbende Fichten mit rot gefärbten Nadeln in der Krone und abfallender Rinde - die Zeichen waren eindeutig. Nur die Intensität, mit der der Borkenkäfer urplötzlich auftrat, erstaunte selbst die Fachleute und traf sie unerwartet.
Ursachen ermittelt
Die Ursachen waren schnell ermittelt. Zum einen die Witterungsbedingungen, mit einer langen warmen und trockenen Wetterlage, welche den Käfern für den Schwarmflug und den Larven für die Entwicklung paradiesische Voraussetzungen boten. Zum anderen waren durch die Winterstürme 2002 / 2003 große Mengen bruttauglicher Hölzer vorhanden. Für zusätzlichen Stress sorgte der reiche Zapfenbehang, der ebenfalls mit Wasser und Nährstoffen versorgt werden wollte. Die Fichte, eigentlich sehr feuchtigkeitsliebend, bekam nicht genug Wasser und konnte somit den wichtigen baumeigenen Abwehrstoff, das Harz, nicht ausreichend bilden. Die Käfer hatten leichtes Spiel und die Forstleute mehr Arbeit, als ihnen lieb war. Denn von den 20 Prozent Kiefernwald in Sachsen-Anhalt, befindet sich der überwiegende Teil im Harz.
Und so muss auch Ronald Nelius, Revierförster im Revier Haferfeld bei Gernrode fast jeden Tag fünf Kilometer zu Fuß und rund 70 bis 100 Kilometer mit dem Auto hinter sich bringen, um in seinem Revier nach dem Rechten zu schauen. Diese Bestandskontrolle kann aber immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein bleiben. "Wir haben eigentlich nur die Chance, zu verhindern, dass die gesunden Baumbestände nicht auch noch übermäßig befallen werden", ist der Revierleiter überzeugt. Denn bei rund 2 300 Hektar zu betreuenden Landeswaldes in seinem Revier, welches sich grob gesehen zwischen den Ortsrändern von Gernrode und Bad Suderode, dem Ostergrund, der Victorshöhe, über Friedrichsbrunn bis hin in Richtung Stecklenberg erstreckt, sind die Chancen, den Schädling immer rechtzeitig in seine Schranken zu verweisen, ziemlich gering. In den noch dazu kommenden 40 Hektar Kommunal- und Privatwald sind 60 Prozent des Gesamtbestandes Nadelhölzer - zu viel für ihn und die vier Waldarbeiter.
Schwere Jahre
Auch für Ronald Nelius war er Sommer 2003 das bisherige "böse Highlight" der Borkenkäfer-Plage. Doch auch die Jahre 2004 mit 4 000 Festmeter und 2005 mit 2 500 Festmeter Schad-Holz seinen nicht ohne gewesen. Und auch in diesem Jahr sind die prognostizierten Schäden schon eine beachtliche finanzielle Größe. In homogenen Beständen sind es im Durchschnitt vier bis acht Festmeter pro Hektar gewesen, die der Säge und der Axt zum Opfer fielen. Diese Zwangsnutzungen führten in den letzten drei Jahren zu fast zehn Hektar Kahlflächen, die zusätzlich wieder aufgeforstet werden mussten.
Noch mehr Ärger
Revierförster Nelius weiß aus seiner Erfahrung, dass, wenn die hohen Temperaturen so anhalten, der August und September noch gewaltig Ärger mit sich bringen werden. Denn wenn die erste Generation der Käfer im Mai ideale Brut- und Fortpflanzungsvoraussetzungen findet, ist die Invasion kaum noch aufzuhalten.
Denn in den ersten Wochen führen die Käfer, von Austrocknung und natürlichen Feinden geschützt, sowie mit Nahrung gut versorgt, ein zufriedenes Leben zwischen Baum und Borke. Die Vorjahreskäfer haben in Bäumen oder im Bodenstreu den Winter gut überstanden und ab einer Außentemperatur von 20 Grad Celsius zieht es sie zum Schwarmflug ins Freie. Das Männchen bohrt sich in einen Stamm ein und legt eine so genannte Rammelkammer an. Das Einbohren beginnt weit oben im Kronenbereich der Fichten. Nur das herabrieselnde feine braune Bohrmehl verrät dem Förster den erfolgreichen Angriff des Käfers. Nach der Paarung nutzt das Weibchen diese Kammer, um Muttergänge zu bohren. 20 bis 100 Eier werden in jedem Gang platziert. Zwischen zehn und 20 Tagen dauert der Entwicklungsprozess der madenartigen Larven, die weiß sind und braune Köpfe haben. Die Larven haben nur eines im Sinn: das große Fressen. Nach weiteren zwei bis vier Wochen - immer abhängig von den Temperaturen - sind die Larven bis zu sechs Millimeter lang und verpuppen sich. Sie brauchen dann weitere zwei Wochen für die Puppenruhe und sich im Reifungsfraß als "vollwertiger" Käfer zu entwicklen. In der Zwischenzeit war die erste Generation aber nicht untätigt und hatte für weitere Nachkommen gesorgt.
In Extremjahren können so drei Generationen entstehen. Überprüfen kann der Forstmann dies mit der "Borkenkäferfalle". Diese schwarzen flachen Blechkästen, mit jeweils 18 Einflugschlitzen auf jeder Seite, werden nicht, wie häufig angenommen, dazu genutzt, um die Käfer zu vernichten. Sie dienen vorrangig der Überwachung und allein zum bestimmen des Beginns der Schwärmzeit und der Größe der Population. Das so genannte Monitoring hilft den Forstleuten, ihre Gegenmaßnahmen oder die Kontrollzyklen zu bestimmen. Kommt der Käfer in Fahrt, zieht es ihn regelrecht zu den Kästen hin. Dort wurde eine chemischer Sexuallockstoff platziert, der die "Liebeswütigen" in eine tödliche Falle lockt. Zu beginn der Schwärmzeit sind hunderte Tiere, die in jeder einzelnen Falle innerhalb einer Woche gefunden werden.
Mühsame Handarbeit
Beginnt diese Phase, kommt der Forstmann im wahrsten Sinn des Wortes ins Laufen. Um überhaupt eine reale Chance zu haben, im Kampf gegen den Forstschädling bestehen zu können, müssen die befallenen Bäume aus den Beständen entfernt werden. Jeder gefällte Baum muss dann mühsam per Hand oder mit Hilfe einer Schälmaschine von der Rinde befreit werden. Die Rinde wird vernichtet, der Baum verarbeitet. "Schaffen wir das nicht, gerät der Borkenkäfer außer Kontrolle und wir können die Massenvermehrung nicht mehr verhindern", weiß Ronald Nelius. Mehr Augenmerk legen die Forstleute und mehr Erfolg versprechen sie sich von einer frühzeitigen Kampfansage.
Schnelle Abfuhr
Dazu zählt vor allem die rechtzeitige Aufarbeitung aller bruttauglichen Schadhölzer aus Schnee-, Eis- und Sturmschäden. Die schnell Abfuhr des Holzes aus dem Wald, um den Insektizideinsatz zu vermeiden. Ein guter Pflegezustand der Bestände und die viele vitale Einzelbäume. Eine wichtige Präventionsmaßnahme ist der Einsatz von Fangbäumen. Je nach Größe des bedrohten Waldes und des vorjährigen Befalles müssen die Forstleute ein paar hundert Festmeter Fangholz besonders präparieren. Diese Arbeit wird entweder von Dezember bis Februar ohne Lockstoffe oder im April und Mai mit Pheromondispensern vorgenommen.
Viele Erfolge
Und da hat sich eine Methode als die erfolgreichste erwiesen: das präparieren von Fangbäumen. Bei ca. 50 Hektar bedrohten Waldes, müssen die Forstleute mehrere hundert Festmeter Fangholz herstellen. Diese Arbeit wird zumeist Ende April bis Anfang Mai erledigt. Auf von Wind und Sturm entwurzelte oder extra gefällte Bäumen, wird ein Insektizid gespritzt, das bei Kontakt dafür sorgt, dass der Borkenkäfer das Zeitliche segnet. So werden die Käfer in eine tödliche Falle gelockt. Ein einzelner Fangbaum kann auf diese Art und Weise bis zu 20 000 Plagegeister vernichten. Diese Arbeit vergibt das Revier zu 70 Prozent an forstliche Dienstleister, den Rest erledigen Nelius und sein Team selbst. "Ansonsten sind wir bemüht, so wenig wie möglich geschlagene Holz im Revier zu belassen. Wir halten kaum Lagerkapazitäten vor und schlagen nach Bedarf ein", umreißt der Revierleiter die Schutzmaßnahmen. Und immer wieder die Hoffnung: Die Witterung möge so sein, dass die Käfer im Zaum gehalten werden können.