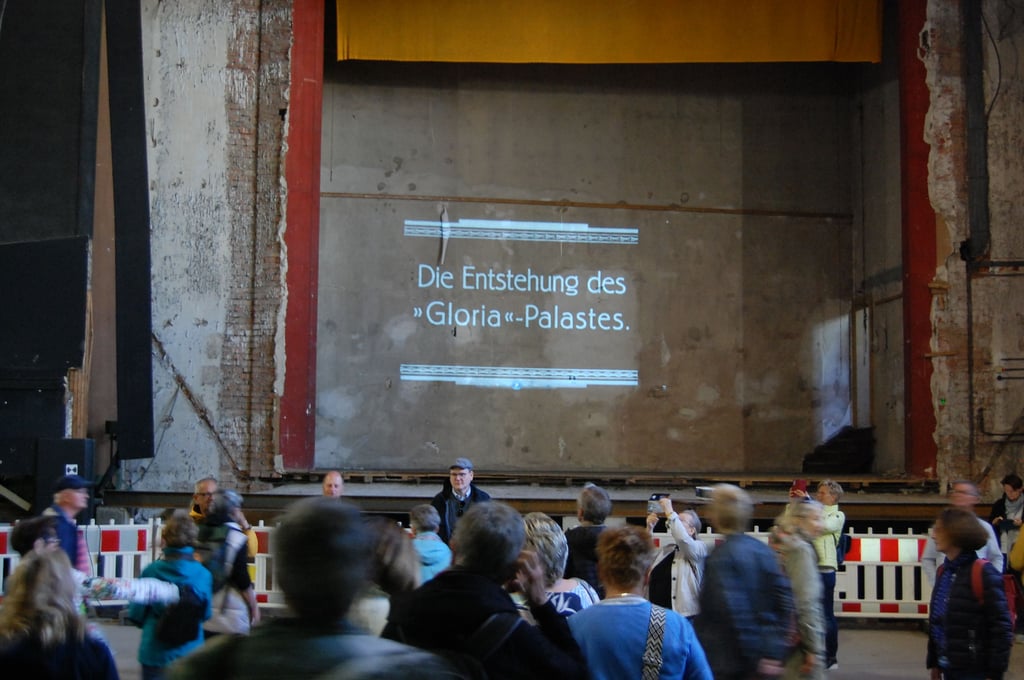Neue Attraktion in Reppichau Neue Attraktion in Reppichau: Die Burg versteckt zum "Sachsenspiegeltag" einen alten Schandfleck

Reppichau - An solchen Tagen geht Erich Reichert nicht im geschäftsmäßigen Zwirn unter die Menschen, sondern standesgemäß in feiner Tunika. Dann nämlich ist Reichert nicht Bürgermeister Reichert, sondern schlüpft in sein alter ego Eike von Repgow, den Verfasser des Sachsenspiegels, der - was nicht bewiesen, aber wahrscheinlich ist - aus Reppichau stammt und ohne weiteres als Stammvater vieler heutiger Rechtsbegriffe und gleichzeitig der schriftlichen Nutzung der deutschen Sprache gelten darf.
Gute Gründe also, dem mittelalterlichen Genius am einstigen Stammsitz seiner Familie praktisch ein ganzes Dorf zu widmen - und seit Samstag hat dieses Dorf einen an Eike orientierten Themenplatz mehr, dessen Einweihung am diesjährigen „Sachsenspiegeltag“ sogar der Bildungsminister des Landes, Marco Tullner, mit seiner Anwesenheit ehrte.
Aufgegriffen haben die Gestalter des Platzes das Thema „Straße der deutschen Sprache“, um damit Eikes Beitrag zur Verschriftlichung des Deutschen hervorzuheben. Was auch den beiden Festrednern, Prof. Uta-Seewald-Heeg und Prof. Jörn Weinert, in einem Maße gelang, das den unglücklichen Umstand vergessen ließ, dass nach Monaten besten Wetters ausgerechnet zur Einweihung des Themenplatzes Petrus plötzlich zu schwächeln begann.
Mit Hilfe von 30.000 Euro aus dem Leader-Programm gelang es die graue Garagenfront umzugestalten
Besonders Weinert schaffte es, dass auch Normalbürger Eikes Leistung so richtig zu würdigen wussten - immerhin hatte der mittelalterliche Ritter es mit seinem Rechtsbuch geschafft, das auch damals schon schwer verständliche Juristen-Kauderwelsch so zu verschriftlichen und so zu „übersetzen“, dass es jedermann eingängig war. Insofern wird es wohl Zeit, dass ein neuer Eike geboren wird. Reppichau hat im übrigen nicht nur eine neue Attraktivität gewonnen, sondern einen Schandfleck verloren.
Denn die vermeintliche Burganlage des Themenplatzes mit durch Kunstschmied Schönemann aus Aluminium geschaffenen Zinnen und Türmchen camoufliert sechs Garagen in Privateigentum, die Reichert in Repgowscher Deutlichkeit als „häßlich, grau, übel“ bezeichnete, wobei in dieses Verdikt der Vorplatz mit eingeschlossen war.
Mit Hilfe von 30.000 Euro aus dem Leader-Programm gelang es, diesem Missstand nachhaltig abzuhelfen und weil auch die Nachbarn mitspielten, wurde nicht nur die Garagenfront durch Kunstmaler Steffen Rogge zur Burg gestaltet, sondern das Burggelände so ausgedehnt, dass es tatsächlich den Platz regelrecht einrahmt. Passenderweise wurde auch ein Teil der Bepflanzung vor den Garagen in der Form gotischer Fenster angelegt. Einziges Manko: Die ruinösen Bauten im Hintergrund stören die Optik des neuen Platzes.
Informationstafeln erklären histroische Hintergründe zur Wandmalerei
Das kann man als Besucher auch dadurch ausblenden, dass man die Informationstafeln liest, die der Ästhetik noch Wissen hinzufügen. Die Texte dazu stammen von Prof. Weinert. In ihnen werden nicht zuletzt die Figuren erläutert, die von der Zinne grüßen.
Sie stellen zum einen zu Eikes Zeiten in der Region vorkommende Volksgruppen dar: die Wenden, die Schwaben, die Thüringer, die Sachsen und die Franken. Zum anderen verweisen die Figuren auf den Adel der Zeit, der hier exemplarisch in den Persönlichkeiten von Heinrich III. von Meißen, und Heinrich I. von Anhalt gewürdigt wird.
Womit gleichzeitig die Askanier und die Wettiner ins Spiel gebracht werden, zwei bedeutende Adelshäuser des Mittealters. Dass beide Häuser in den Zusammenhang mit Eike gestellt werden, hat guten Grund: Von den sechs noch vorhandenen Urkunden, die Eike selbst unterzeichnet hat, beziehen sich drei auf Wettin und drei auf die Askanier.
Und weil der Markgraf von Meißen auch noch als wichtiger Vertreter der mittelhochdeutscher Dichtung gilt, schließt sich ein sprachlicher Kreis, der durch Porträtgemälde von Luther und Eike an der Giebelwand abgerundet wird. (mz)