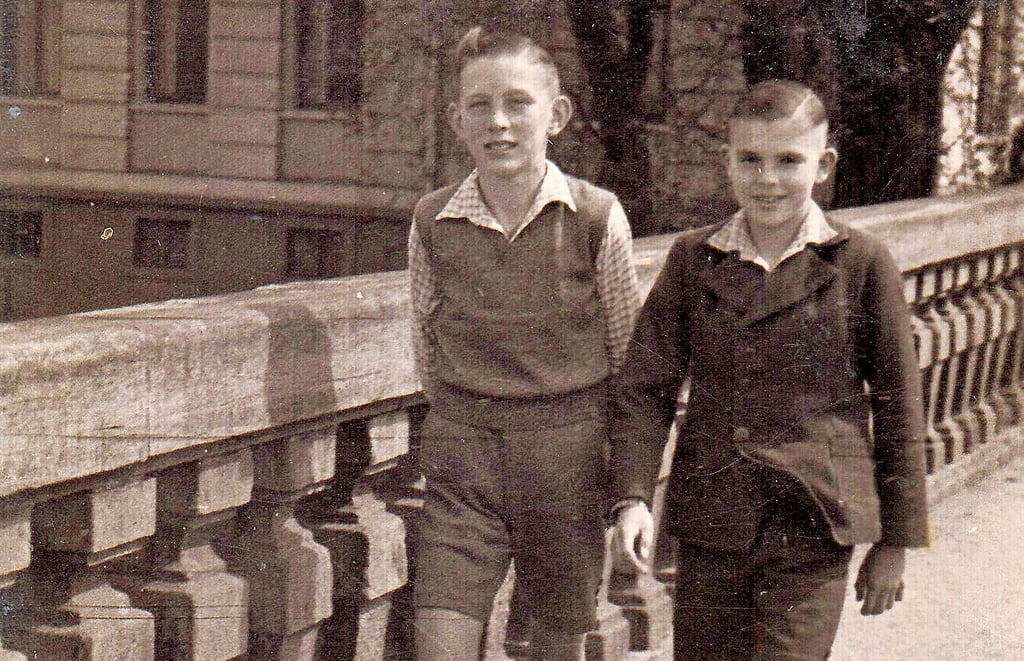Tod und Sterben in vergangenen Jahrhunderten Tod und Sterben in vergangenen Jahrhunderten: Hallesche Höllenqualen

Halle (Saale) - Innerhalb weniger Monate raffte es die ganze Familie dahin: den fünfjährigen Christoff Heinrich, die neunjährige Anna Gertraudte, Maria Elisabeth (16), Anna Dorothea (die gerade mal vier Jahre alt wurde), Hans Christoff mit 22 und schließlich auch die Eltern Barbara Elisabeth und Andreas.
Die Grundmanns, wohnhaft in der halleschen Fleischhauergasse (heute Mittelstraße), wurden zwischen Oktober 1681 und März 1683 Opfer der Pest - wie fast die Hälfte der Einwohner der Stadt. Heute erinnern die Pestsäule am Universitätsring, die ihren ersten Standort 1455 am Galghügel (heute Riebeckplatz) hatte, und das Graseweghaus - das Viertel, in dem Pestkranke eingemauert wurden und später „Gras über die Toten“ gewachsen ist - an die Schrecken der Pest in Halle.
Tod und Sterben in der frühen Neuzeit in Halle
Mit den Themen Tod und Sterben in der frühen Neuzeit in Halle hat sich die Historikerin Katrin Moeller in einer wissenschaftlichen Arbeit befasst. Drei Jahre lang hat die Leiterin des Historischen Datenzentrums Sachsen-Anhalt an der halleschen Universität gemeinsam mit elf Mitarbeitern Quellen zum Leben und vor allem Sterben in Halle studiert.
In den Kirchenbüchern der Mariengemeinde konnten die Wissenschaftler über 400.000 Biografien zwischen 1670 und 1820 von der Geburt bis zum Tod nachverfolgen - zunächst nur für das damalige Marienviertel. Weitere Forschungen und auch eine Publikation sollen folgen.
Menschen starben nicht nur an der Pest
Die Menschen starben natürlich nicht nur an der Pest. Kriege wie der Dreißigjährige Krieg forderten unzählige, auch zivile Opfer, ebenso die Pocken, die 1799 nach einem Hochwasser als Epidemie über der Stadt hereinbrachen. Auch Hungerkrisen - in Halle um 1770/72 und noch einmal um 1805/6 - sowie die Befreiungskriege 1813 (Halle war Lazarettstadt) treiben die Sterbestatistik in die Höhe. Andere „alltägliche“ Ursachen waren „Jammern und Zahnen“, Entkräftung und Infektionen.
Tragisch zum Beispiel ist die Geschichte der Charlotte Noth. Die Hallenserin bekam um 1804 Brustkrebs, eine damals noch eher seltene Krankheit. In ihrer Verzweiflung entschloss sie sich zu einem riskanten Schritt: Sie ließ sich beide Brüste abnehmen. Die Wunde entzündete sich jedoch und Charlotte Noth starb schließlich an Wundbrand und „Inflamation“.
Auch Ertrinken war häufige Todesursache
Auch Ertrinken war häufige Todesursache. So fiel die dreijährige Tochter des Baders und Feldschers Johann Diez Ende des 16. Jahrhunderts in den Hausbrunnen - ein häufiger Tod. „Auch in der Saale fand man oft den Tod“, so Katrin Moeller. So ertrank ein Student Mitte des 19. Jahrhunderts beim „Fallen aus dem Boot“.
Die 1715 geborene Dorothea Catharina Dopplerin wurde 1739 als Kindsmörderin in der Saale ertränkt - und landete in der Anatomie. Manchmal kamen Menschen aber auch ganz profan zu Tode: Eleonora Christiana Kummer fiel am Markt 725 (etwa an der Thalia-Buchhandlung) ein Stein vom Gesims auf den Kopf. (mz)