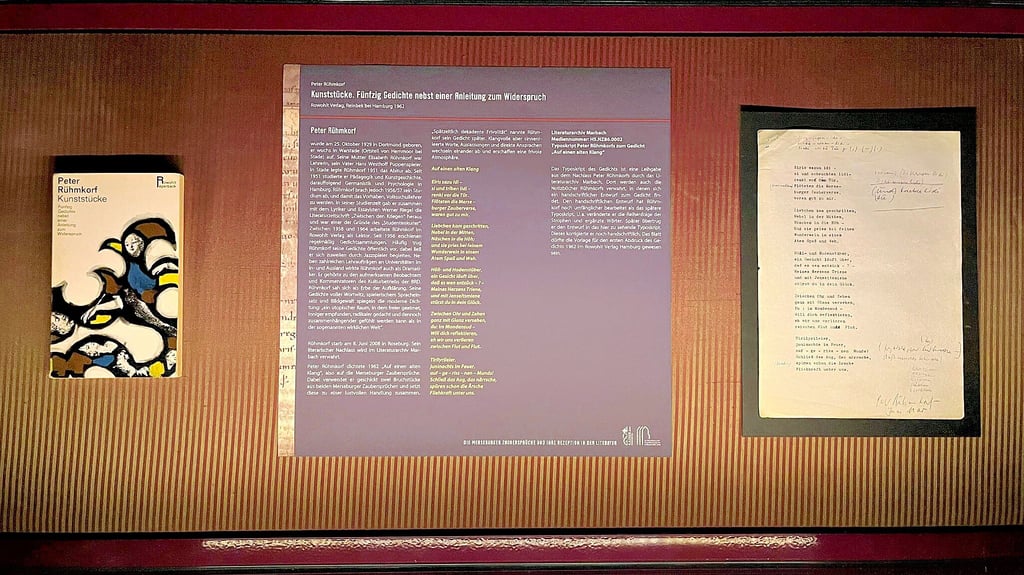"Soko 5113": Als Rauchen noch erlaubt war

München - Die Hosen hatten Schlag, die Hemden waren eng, die Haare lang und die Männer trugen gerne Schnauzer. Willkommen in den siebziger Jahren, als die Luxusstadt München noch viele abgewohnte Ecken hatte und Zigaretten zum Lebensgefühl gehörten.
Für Nostalgiker gibt es jetzt eine Zeitreise auf ZDFneo. Ab dem 2. Januar 2018 um 14.00 Uhr laufen dort die ersten sechs Folgen der Krimi-Serie „Soko 5113”, die auf den Tag genau 40 Jahre zuvor Premiere im Fernsehen feierte. Damit sind die Geschichten rund um die Münchner Ermittler die älteste Serie im deutschen Fernsehen. Wegen des Erfolgs wurde das später in „Soko München” umbenannte Format auf andere Städte übertragen. Auch in Wien, Köln, Leipzig, Stuttgart, Kitzbühel und Wismar gibt es seit Jahren eigene „Soko”-Teams.
Den Anstoß zu der Krimireihe gab Dieter Schenk, damals Leiter der Kriminalpolizei im Polizeipräsidium Gießen - weil er unzufrieden war mit „Derrick” und Co. „Als damaliger Fachmann für die Kripo habe ich mich öfter auch über die Fernsehkrimis geärgert, weil die so gar nicht mit der Praxis übereinstimmten”, erinnert sich der 80-Jährige, der im hessischen Schenklengsfeld und in Berlin lebt. „In erster Linie ging es damals darum, dass ein Held oder eine Leitfigur wie der Derrick alles Wichtige selber bestimmte und auch die Erfolge erzielte.”. Mitarbeiter waren höchstens Zuträger. „Aber die Polizei ist Teamwork”, sagt Schenk, der die Macher der Serie mit seinem Fachwissen bis heute berät.
Also setzte sich der Ermittler hin und schrieb ein Buch über einen jungen Polizeianwärter, mit realistischem Anspruch. In den anderen Krimis sei alles immer sehr glatt abgelaufen. Schenk brachte auch Probleme mit rein, den Personalmangel, unzureichende Ausrüstung oder der ungeheure Verwaltungsaufwand, der auch im wahren Leben absurde Blüten treiben konnte. Einmal habe die Poststelle einen Brief in einer Mordsache an den Absender zurückgeschickt, weil der Brief nicht ausreichend frankiert war, erzählt Schenk. Das Problem: „Der Brief enthielt aber den ausschlaggebenden Hinweis zur Klärung dieses Mordes”.
So müssen sich auch die Beamten von „Soko 5113” gleich in ihrer ersten Folge „Einsatz: 22 Uhr” mit Alltagsproblemen rumärgern. Es gibt keinen Dienstwagen. Alle Ermittler sind überarbeitet und schieben Berge von Überstunden vor sich her, während die Verwaltung Punkt 15.30 Uhr den Stift fallen lässt, das Nachtlicht am Büro-Aquarium einschaltet und nach Hause geht.
Auf der Frankfurter Buchmesse 1975 hatte Schenk mit seinem realistischen Blick auf die Polizeiarbeit Glück: Ein Verleger interessierte sich nicht nur für sein Buch, er leitete es auch ans ZDF weiter. Fehlte nur noch ein Name. Doch Schenk hatte eine Idee. Er erinnerte sich an die Zeit, als er mal eine Sonderkommission im Frankfurter Bahnhofsviertel leitete. Seine Telefonnebenstelle damals: 5113.
1978 lief dann die erste Folge von „Soko 5113”, damals mit Werner Kreindl als Chef des Ermittlerteams sowie Bernd Herzsprung, Wilfried Klaus und Diether Krebs. Sogar der ehemalige Münchner Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) war 2013 in einer Folge zu sehen und spielte sich selbst, wie er die Polizisten lobt: „Mit ihrer Arbeit haben sie das Leben in der Landeshauptstadt und in unserem schönen Bayern sicherer und damit lebenswerter gemacht”.
Doch sieht Polizeiarbeit wirklich so aus? Nein, gibt Schenk zu. „Die ganze Tätigkeit der Kriminalpolizei muss schriftlich abgebildet werden in einer Ermittlungsakte.” Statt spektakulärer Verbrecherjagden also viele Vermerke und Protokolle, Unmengen Papierkram. Nicht geeignet fürs Fernsehen, weiß Schenk. „Wenn es diese Realität abbilden würde, wäre das sehr langweilig.” (dpa)