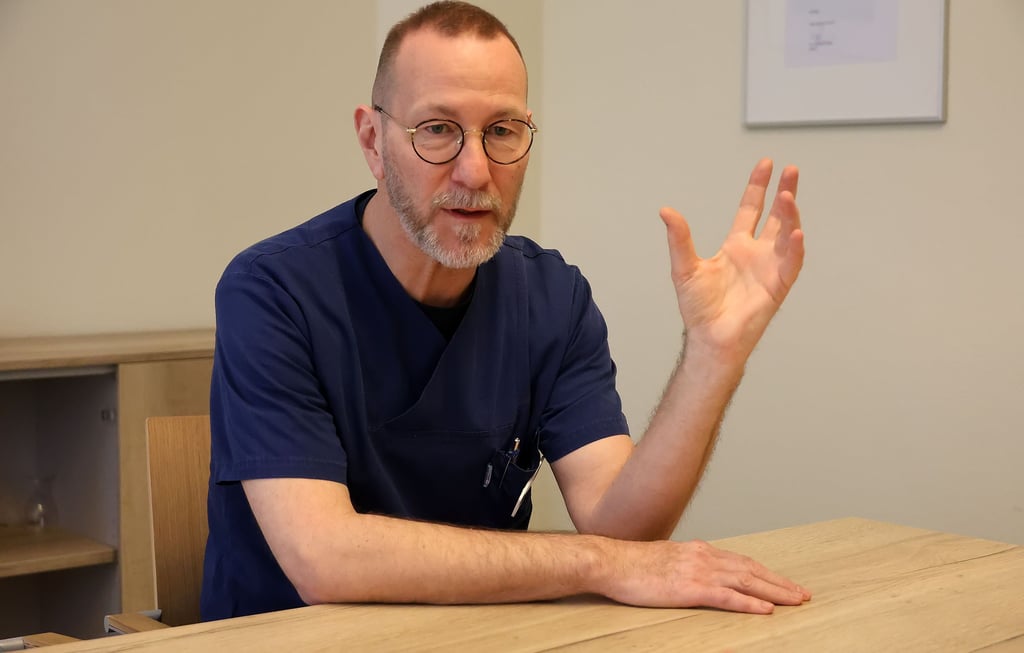Schlossmuseum Quedlinburg Schlossmuseum Quedlinburg: Verdrängtes kommt ans Licht
Quedlinburg/MZ. - «Am 8. April habe ich eine Trauung am unteren Altar halten müssen, bei zur Hälfte im mittleren Kirchenschiff umgelegten Bänken… Ich kam mir wie in einer Rumpelkammer vor. Ihr habt eine Mördergrube daraus gemacht.» Es sind verzweifelte Worte, die der Pfarrer der Quedlinburger Stiftskirche, Rudolf Hein, zu Ostern 1938 seinem Tagebuch anvertraut. Wenige Monate zuvor hatte die Gemeinde unter Zwang ihre Kirche den Nationalsozialisten überlassen müssen. Der Reichsführer SS, Heinrich Himmler, wollte die letzte Ruhestätte Heinrichs I. zur «Weihestätte» machen.
Dass Heins Zeilen nun erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sind, ist einer neuen Ausstellung im Quedlinburger Schlossmuseum zu verdanken, die, seitdem sie vor mehr als viereinhalb Jahren erstmals ins Auge gefasst wurde, umstritten ist.
Rund 350 000 Euro hatten Bund und Land insgesamt für die Überarbeitung der Dauerausstellung bereitgestellt - unter der besonderen Maßgabe, sich endlich auch der NS-Geschichte anzunehmen, erinnert sich der Direktor der städtischen Museen, Christian Mühldorfer-Vogt. Ein schwieriges Unterfangen - sowohl aus baulicher als auch aus konzeptioneller Sicht. Die Westkrypta des Quedlinburger Schlosses ist das einzige bauliche Zeugnis der Stadt aus der Zeit der Ottonen vor über 1000 Jahren.
Allerdings auch ein Ort, der lange als Rumpelkammer sowie als Tanzlokal diente. Es dauerte mehr als zwei Jahre länger als geplant, um den maroden Bau zu stabilisieren und allen Auflagen der Denkmalschützer Genüge zu tun. Als nicht weniger problematisch erwies sich das Vorhaben des Historikers Mühldorfer-Vogt, die Geschichte von Heinrich I., der ottonischen Kaiser und Könige sowie deren Vereinnahmung durch die Nazis in den Kreuzgewölben darzustellen.
Ein diffuser Widerstand machte sich breit in der Stadt: Namhafte Bürger warnten, es könnte eine neue Wallfahrtsstätte für braune Jünger entstehen, die evangelische Kirche versuchte, Einfluss auf die Gestaltung der Ausstellung zu nehmen. «Ich weiß nicht, woran es lag, dass es so viele Ängste und Vorbehalte gab», sagt Christian Mühldorfer-Vogt. Dabei hätte sich gerade die Kirchengemeinde während der Vereinnahmung ihres Gotteshauses «wacker geschlagen».
Trotz zum Teil hitziger Diskussionen sind nicht alle Vorbehalte ausgeräumt. Andererseits stellte der einstige Dompfarrer, Friedemann Goßlau, Fotos aus seinem Privatbesitz zur Verfügung, die Himmlers Heinrichs-Kult bloß stellen: Statt der angeblich bei Grabungen in der Kirche gefundenen Gebeine des Königs hatten die Nazis 1937 nur ein paar Bretter und einen Schädel aus einem anderen Grab bestattet. Für die Ausstellung sind diese Fotos ein Glücksfall, bekennt der Museumsleiter. Denn es sind nur 36 Quadratmeter, die Mühldorfer-Vogt zur Verfügung stehen, all das zu erzählen, was über ein halbes Jahrhundert verschwiegen wurde.
Zusammen mit dem Quedlinburger Grafik- und Designbüro Signa entschied man sich für eine Mischung aus Bildtafeln und Installation. Mit knappen Worten, Fotos und Dokumenten wird erläutert, wie die Ottonen und Heinrich für den Rassenwahn, die aggressive Ostpolitik und die Kirchenfeindlichkeit der Nazis missbraucht wurden. Für dere mörderische Konsequenz steht wiederum ein Menschenschicksal - das der 17-jährigen Roma Else B. aus Quedlinburg, deren Spuren sich in Auschwitz verlieren.
Wer zum Ausgang strebt, muss am «Müllhaufen der Geschichte» vorbei, wie es Mühldorfer-Vogt nennt: Die Bruchstücke des Reichsadlers, der einst die Apsis der Stiftskirche verunzierte, liegen neben einem riesigen, in Stacheldraht gehüllten Kerzenleuchter. Das Ganze wird in gleißendes, fast schmerzendes Licht getaucht. «Bloß keine Reichsparteitagsatmosphäre», macht der Museumsleiter klar.
Die Ausstellung im Schlossmuseum ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.