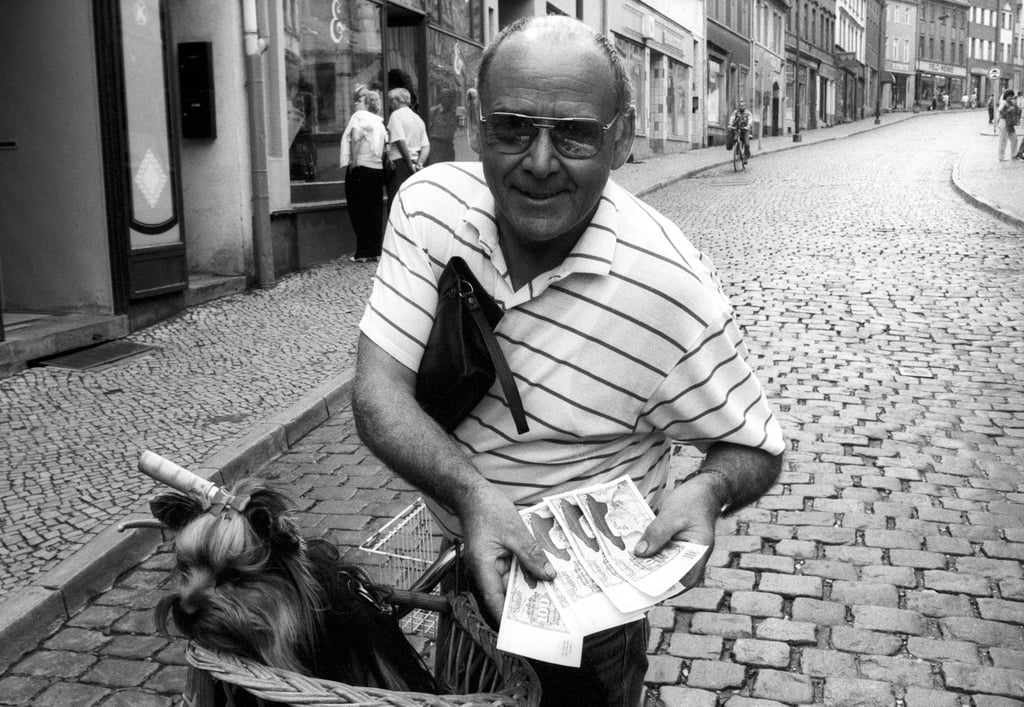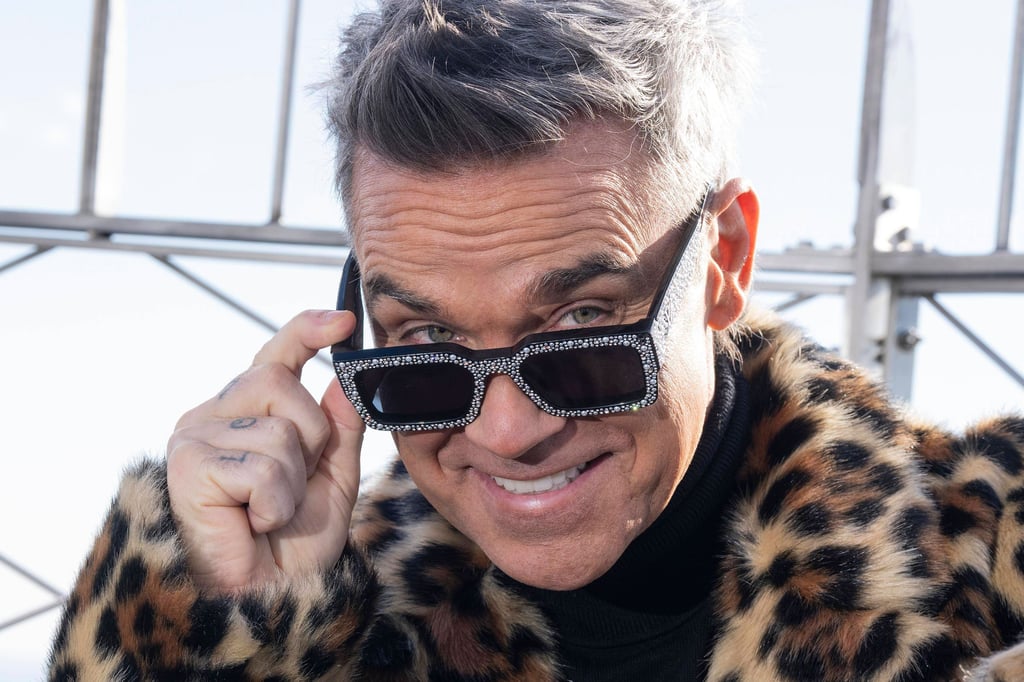Ausstellung in Weißenfels Ausstellung in Weißenfels: Musikalisches Mäusenest im Heinrich-Schütz-Haus

Weißenfels/MZ - Zu Zeiten von Heinrich Schütz hatten die Mäuse einen sehr erlesenen Musikgeschmack. Zumindest jene Nager, die im Weißenfelser Haus des Komponisten Unterschlupf gefunden hatten. Das zentrale Exponat in der Dauerausstellung des Schütz-Hauses belegt das: Ein Mäusenest aus dem 17. Jahrhundert, in dem fein zerlegte Blätter verbaut waren.
Bis Ende der 70er Jahre war das Gebäude in der Weißenfelser Nikolaistraße ein Wohn- und Geschäftshaus. Seit 1985, dem 400. Geburtstag von Heinrich Schütz, wird dessen einstiges Wohnhaus museal genutzt. Bereits drei Jahrzehnte früher, im Jahr 1956, wurde in der Saalestadt eine erste Gedenkstätte für den Komponisten eröffnet. Seit 2006 steht das Schütz-Haus als einer von 21 Gedächtnisorten von besonderer nationaler Bedeutung in den neuen Ländern im Blaubuch der Bundesregierung.
Es wurde während der Restaurierung des Gebäudes vor fünf Jahren entdeckt. Auf den Schnipseln sind Noten zu erkennen, die von Schütz’ Hand stammen. Diese Auspolsterung war gewiss sehr kuschlig. Auch wenn das Motto „Mein Lied in meinem Hause“ – unter dem die 2012 eröffnete Schau steht – durch die tierischen Mitbewohner sehr freizügig gedeutet wurde. Und natürlich ist in dem jüngst erschienenen Katalog des Weißenfelser Schütz-Hauses das musikalische Mäusenest abgebildet.
Der Leipziger Lehmstedt-Verlag hat das Begleitbuch zur Dauerausstellung dezent und mit viel Augenmaß gestaltet. Neben bündigen Informationen zu Leben und Werk des barocken Tonsetzers finden sich auch Ausführungen zu Weißenfels’ städtischer Kultur des frühen und späten 17. Jahrhunderts, also zu jenen Zeitphasen, in denen Schütz als Kind in der Saalestadt aufwuchs und seinen Lebensabend im Schatten von Schloss Neu-Augustusburg verbrachte.
Sorgloser Umgang mit dem Erbe
Freilich wussten nicht nur die Mäuse, sondern auch Schütz’ menschliche Zeitgenossen dessen Leistung zu würdigen: Bereits zu Lebzeiten hat man den 1585 in Köstritz geborenen und 1672 in Dresden gestorbenen Komponisten als „Vater der modernen deutschen Musik“ gefeiert. Er war Verfasser von zahllosen geistlichen Musiken und Schöpfer der ersten deutschen Oper. Von dem Werk „Dafne“ ist zwar Martin Opitz’ Libretto überliefert, nicht aber Schütz’ Musik.
Wie im Katalog zu lesen, war das Stück eher ein Singspiel als eine Oper, dennoch leistete es einen Beitrag zur Entwicklung derselben. Dass die „Dafne“-Musik verloren ging, überrascht nicht. Die Nachlassverwalter gingen mit Schütz’ Hinterlassenschaft recht sorglos um. Nicht aus Bosheit, sondern weil die Menschen des 17. und 18. Jahrhunderts, so der Katalog, „noch keine kulturelle Erbepflege im heutigen Sinn“ kannten.
Der Mangel an überlieferter Quantität ändert nichts an der Qualität von Schütz’ Schöpfungen, an seiner herausragenden Bedeutung für die abendländische Musik. Gleichzeitig ist er ein sympathischer, weil friedlicher Gegenpol zu den Berühmtheiten des 17. Jahrhunderts. „Wenn es aber eine Gegenfigur zu Wallenstein, Tilly und Gustav Adolf gibt, dann doch wohl diese“, schrieb Martin Gregor-Dellin in seiner Biografie von 1984.
Weitere Informationen zu Heinrich Schütz lesen Sie auf Seite 2.
Schütz war, so ist im Katalog zu lesen, der erste deutsche Komponist von internationalem Rang – und ein tiefgläubiger Mensch, dem zeitlebens auch eine gewisse Melancholie eigen war. Den Hang zur Schwermut hat aber nicht erst Günter Grass in der Erzählung „Das Treffen in Telgte“ (1979) seinem fiktiven Schütz mitgegeben, sondern bereits Christoph Spetner, der um 1660 ein Gemälde des alten Heinrich Schütz anfertigte. Auf diesem hält er, in das Gewand eines Geistlichen gekleidet, als Kennzeichen des Musikers ein gerolltes Notenblatt in der rechten Hand.
Wie im Buch zur Weißenfelser Ausstellung zu erfahren ist, benutzte man dergleichen im Barock – lange vor Erfindung des Taktstockes Anfang des 19. Jahrhunderts – zum Dirigieren. „Mit nichts anderem gebietend als mit einer Notenrolle und dem Wort, verschaffte er sich Achtung bei Fürsten und Herrn“, heißt es diesbezüglich in Gregor-Dellins Biografie.
Die „Klause“ unterm Dach
So öffentlich das Amt des Dirigenten Schütz, so abgeschlossen war das Dasein des Produzenten von geistlicher und weltlicher Musik. In seinem Weißenfelser Wohnhaus hatte Schütz sein Arbeitszimmer unterm Dach. Er selbst nannte es seine „Klause“. Im Zuge der Restaurierung im Jahr 2010 gelang es, den historischen Zustand der Komponierstube zu großen Teilen wiederherzustellen.
In der weltabgeschiedenen Kammer schrieb Schütz, der 50 Jahre als Hofkapellmeister in Dresden wirkte, zahllose Werke. Heute steht in dem Dachzimmer eine schwarze Glaswand mit eingelassener Vitrine, in der zwei weitere Notenfragmente von der Hand des Meisters zu sehen sind. Auch die wurden bei der Restaurierung 2010 im Schütz-Haus gefunden. Überhaupt wird die Restaurierungsgeschichte des Weißenfelser Schütz-Hauses im Begleitbuch detailliert aufbereitet.
Die Anerkennung, die das Schütz-Haus für seine neue Ausstellung erhielt, kann auch dem Katalog gezollt werden: Das Begleitbuch ist eine gediegene Ergänzung zu einer vorzüglichen Schau über das Leben und Werk jenes bemerkenswerten und dennoch so bescheidenen Mannes, der sich, so Gregor-Dellin, „mit seiner Person niemanden aufgedrängt hat“.
„Mein Lied in meinem Hause“. Heinrich-Schütz-Haus Weißenfels. Hrsg. von Henrike Rucker. Lehmstedt Verlag, Leipzig 2014, 160 S., 19,90 Euro