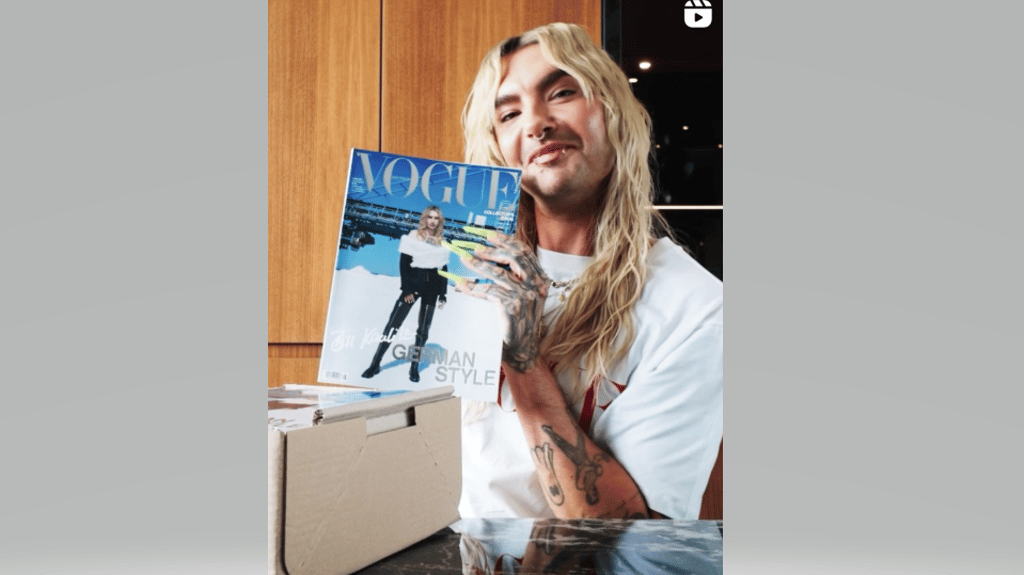Vorurteile von Nichtwählern Vorurteile von Nichtwählern: "Politiker versprechen alles und halten nichts"
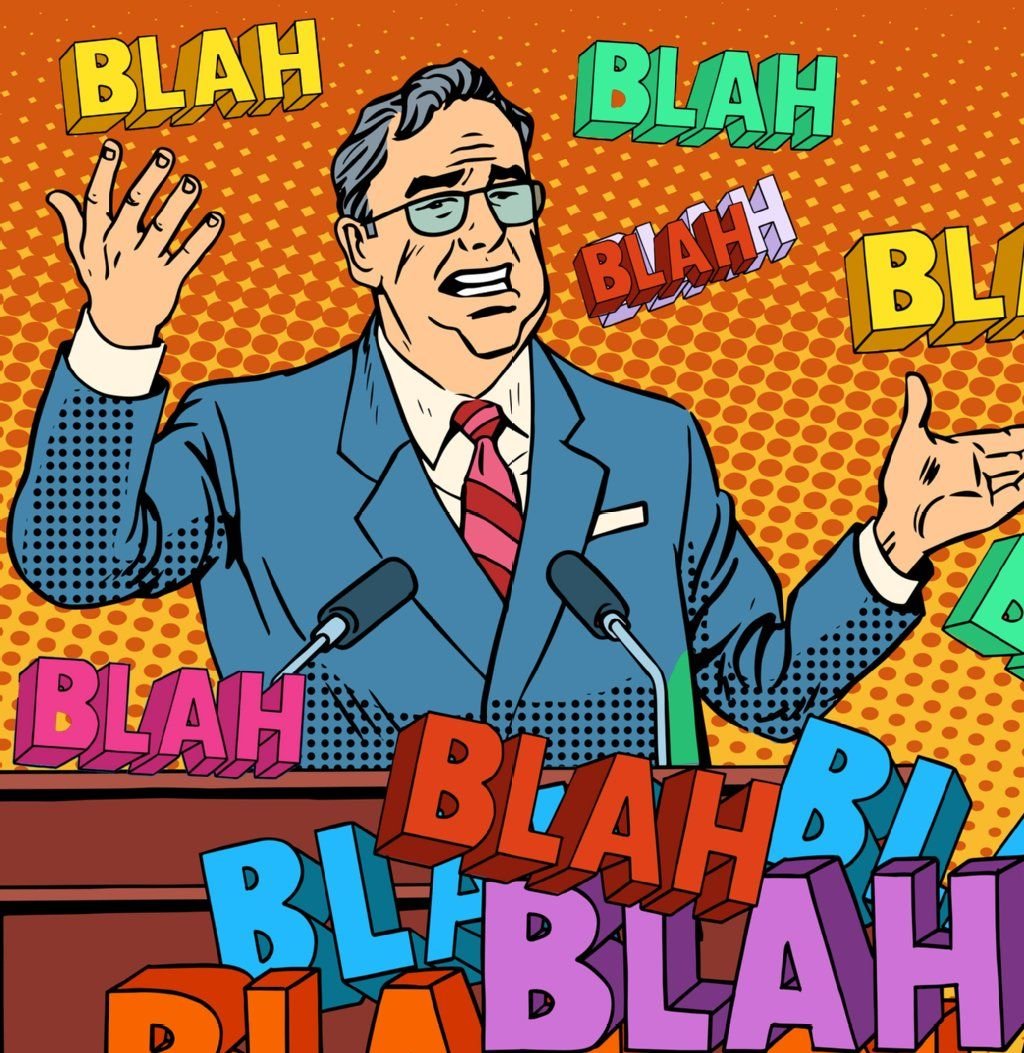
Halle (Saale) - Am 13. März wird der neue Landtag von Sachsen-Anhalt gewählt. Das elektrisiert nicht jeden. Viele Sachsen-Anhalter sind bei der Wahl 2011 zu Hause geblieben. Eine Studie hat ermittelt, warum das so war. Die Mitteldeutsche Zeitung setzt sich in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung mit Klischees und Vorurteilen von Nichtwählern auseinander. Heute: „Ich bin doch nicht blöd und geh’ wählen, weil Politiker immer alles versprechen und anschließend nichts halten.“
Entschlossen reckt das Mädchen auf dem Wahlplakat der SPD den rot gefärbten Malerpinsel in die Luft. Auf ihrem Kopf trägt sie einen Hut aus Zeitungspapier. Darüber steht: „Wir streichen nicht eine einzige Schule. Sondern alle“. Kurzes Innenhalten. Meinen die das ernst? Schulen schließen ist politisch keine besonders populäres Ziel. Doch dann: Das Mädchen, Malerpinsel, streichen. Alles klar.
Das Plakat war eines der auffälligsten im Wahlkampf 2011. Marktschreierisch und provokativ, aber auch im besten Sinne plakativ. Auf wenig Platz wurde eines der zentralen Wahlversprechen der SPD verkündet: die Schulsanierung. Die hatte sich der Spitzenkandidat Jens Bullerjahn auf die Fahnen geschrieben. Kolossale 600 Millionen Euro stellte er zum Aufmöbeln der Schulen im Land in Aussicht.
Die versprach Kanzler Helmut Kohl (CDU) 1990 für die neuen Länder. Zahlen wollte er das „aus der Portokasse“. Es kam anders. Im Juli 1991 wurde erstmals der Solidaritätszuschlag erhoben - auch für die Unterstützung der neuen Länder. Er ist bis heute erhalten geblieben.
Vor der Landtagswahl 1994 schloss der SPD-Spitzenkandidat Reinhard Höppner aus, sich für seine Minderheitsregierung mit den Grünen von der PDS tolerieren zu lassen. Nach der Wahl passierte genau das. Mit Stimmen der PDS wurde Höppner zum Ministerpräsident gewählt. Das so geschaffene Magdeburger Modell bestand bis 2002.
SPD und die Grünen versprachen zur Bundestagswahl 2002, das Sozialsystem weitestgehend unangetastet zu lassen. „Keine Einschnitte“ war der Slogan. Mit den Hartz-IV-Reformen baute Rot-Grün den Sozialsektor dann so stark um, wie keine andere Regierung in der Nachkriegszeit.
Im Bundestagswahlkampf 2005 versprach die SPD, dass sie die Mehrwertsteuer von 16 Prozent unangetastet lassen wolle. Damit grenzte sie sich von der CDU ab, die zwei Prozentpunkte mehr forderte. Nachdem beide Parteien eine Koalition gebildet hatten, wurde doch erhöht: auf 19 Prozent.
Steuerentlastungen in Milliardenhöhe versprach FDP-Chef Guido Westerwelle im Wahlkampf 2009. Als Juniorpartner der CDU wurde daraus aber nichts. Allein die Hotelbesitzer konnten sich über Begünstigungen freuen - Stichwort „Mövenpick-Steuer“. Den Liberalen wurde das wiederum als Klientelpolitik ausgelegt. (jul)
Nun sind Wahlversprechen allerdings so eine Sache. Ein Sprichwort sagt: „Selten wird so viel gelogen, wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd“. Der Satz wird oft dem Reichskanzler und gebürtigen Sachsen-Anhalter Otto von Bismarck zugeschrieben. Belegen lässt sich das allerdings nicht. Sicher ist jedoch, dass das Zitat schon mehr als 100 Jahre kursiert. Und sein Inhalt scheint sich in den Köpfen der Menschen festgesetzt zu haben. Bei einer Umfrage gaben 2006 nur zehn Prozent der Interviewten an, dass sie Wahlversprechen glauben. 90 Prozent gingen also davon aus, dass Politiker ihre Versprechen nach der Wahl brechen.
40 Prozent heiße Luft?
Dabei ist das Scheitern von Vorhaben nicht der Regelfall. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2012 hat ergeben, dass in Deutschland 60 Prozent der Wahlversprechen auch wirklich umgesetzt werden. Drei Viertel davon sogar genau so, wie zuvor angekündigt. Angesichts der Skepsis der Wähler sind das erstaunlich gute Werte. Diese Statistik könnte man aber auch ins Gegenteil verkehren. 40 Prozent des Wahlkampfgetöses wären demnach heiße Luft.
Allerdings würde man damit wesentliche Bestandteile des politischen Prozesses verkennen. Den Lärm beim Werben um Wähler kann man abschreckend finden, jedoch hat er eine Funktion. Er soll Menschen begeistern und mobilisieren. Mit der Aussage, dass man vielleicht ein paar Schulen sanieren wolle, schafft man das eben eher schlecht. Hinzu kommt, was für Reden und insbesondere für Plakate gilt: Verkürzungen und Pointierung sind dort notwendig. Um bis ins Detail abzuwägen, reichen Zeit und Platz oft einfach nicht aus.
Um die 40 Prozent zu erklären, ist jedoch weitaus wichtiger, was nach der Wahl passiert. Kommt man als Partei in Regierungsverantwortung, dann ist man dort selten allein. In Großbritannien zum Beispiel, wo ein Mehrheitswahlrecht gilt und nur eine Partei an der Macht ist, können 85 Prozent der Versprechen realisiert werden.
In Deutschland bilden jedoch zumeist zwei oder gar drei Parteien eine Koalition. Schon dadurch muss von Vorhaben Abstand genommen werden. So versprach die CDU in Sachsen-Anhalt 2011: „Mit uns gibt es keine Experimente an den Schulen.“ Der SPD musste sie in den Koalitionsverhandlungen dann aber doch zugestehen, was sie als ein solches Experiment empfand: die Gemeinschaftsschule. Als „extrem schmerzhaft“ beschrieb das der CDU-Abgeordnete Thomas Leimbach.
Doch auch nachdem sich von den ersten Vorhaben verabschiedet wurde, ist die Umsetzung der übriggeblieben keineswegs sicher. Regierungen können Gesetze ja nicht einfach erlassen. Sie durchlaufen sowohl einen parlamentarischen als auch öffentlichen Prozess. Im Landtag werden sie von Fraktionen, Fachgruppen und Ausschüssen gelesen und geprüft. Das führt immer auch zu Veränderungen. Der frühere SPD-Bundesverteidigungsminister Peter Struck formulierte es in seinem „ersten Struckschen Gesetz“ einmal so: „Kein Gesetz kommt aus dem Parlament so heraus, wie es eingebracht wurde.“
Andere Akteure
Hinzu kommen die äußeren Faktoren. Ein Beispiel: Schuldenabbau war eines der zentralen Wahlversprechen der aktuellen schwarz-roten Koalition. Dazu legte Finanzminister Bullerjahn ein Einsparungs-Konzept vor. 50 Millionen Euro sollten bei den Hochschulen gekürzt werden. Die sahen sich damit komplett überfordert. Es folgten ein zähes Ringen in der Regierung (CDU-Wissenschaftsministerin Birgitta Wolff kostete es den Job) und Massenproteste von Studenten. Anstelle der 50 Millionen Euro wurden schließlich mildere Konditionen vereinbart.
Dass Politik von anderen Akteuren abhängig ist, zeigte sich ebenso in der Wirtschaft. Dort wollte die CDU die Solarindustrie fördern und ausbauen. 2012 gingen jedoch mit Sovello und Q-Cells zwei tragende Säulen der Branche im Land pleite. Rettungsversuche schlugen fehl. Die Solarindustrie hat sich bis heute nicht erholt. Oder Beispiel Bürgerarbeit: Das Programm für Langzeitarbeitslose wurde in Sachsen-Anhalt mitentwickelt und lief hier sehr erfolgreich. 2014 beendete es der Bund aber. Protest zwecklos. Und das versprochene Folgeprogramm wurde seitdem nicht gestartet.
Doppelte Streichung
Diese Beispiele zeigen, dass die 40 Prozent unerfüllter Versprechen oft keine falschen Versprechen sind. Sie sind Opfer des normalen politischen Prozesses und der äußeren Umstände. Zweifelsohne sollte aber immer die Frage gestellt werden, ob man das hätte vorher wissen können.
Und das Kind mit dem Pinsel? Das Streichen von Schulen gab es, und das im doppelten Wortsinn. Seit 2012 wurden 100 Sanierungs- und Modernisierungsprojekte von Bildungseinrichtungen mit 154 Millionen Euro unterstützt. Weitere sollen in den kommenden Jahren folgen. 750 Millionen Euro will man dafür ausgeben. Gestrichen - also geschlossen - wurde allerdings auch. Mehr als 30 Schulen vor allem im ländlichen Raum wurden wegen zu geringer Schülerzahlen zu gemacht. Ob damit das Versprechen auf dem Pinsel-Plakat gebrochen wurde, muss wohl jeder für sich entscheiden. (mz)