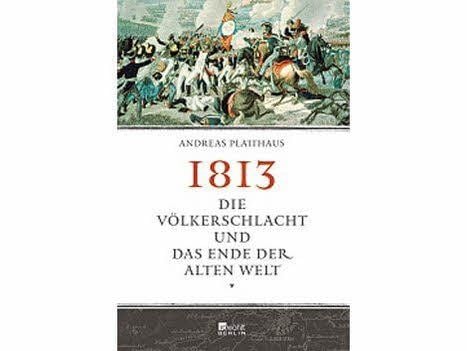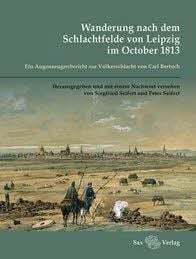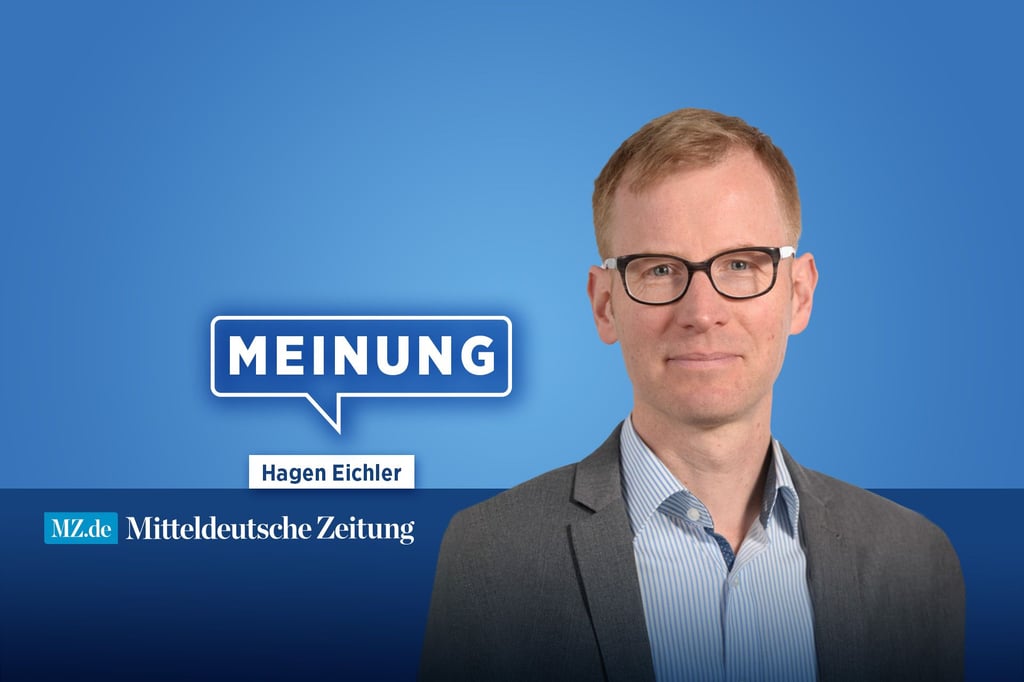Völkerschlacht bei Leipzig Völkerschlacht bei Leipzig: "Schiffbruch auf festem Lande"

halle (saale)/MZ - Es hätte nicht Leipzig sein müssen. Noch wenige Wochen vor der Schlacht war offen, wo es zur Entscheidung zwischen Napoleon und seinen Gegnern kommen würde. Die ließen sich Zeit. In dem an Sachsen grenzenden Böhmen sammelten Russen, Preußen und Österreicher ihre Hauptstreitmacht, bevor sie Ende September bedächtig nach Norden zogen. Derweil irrlichterte Napoleon durch die Landschaft?- auf der Suche nach dem Gelände, auf dem er die letztgültige Begegnung erzwingen wollte. Ein Katz-und-Maus-Spiel, in dem der Kaiser die Maus gab. Napoleon trieb es in die Gegend von Bad Düben, wo er im Schloss nächtigte. Es wurde vermutet, dass er die Schlacht bei Berlin oder im Oderland austragen wollte. Oder vielleicht doch in Großgörschen bei Lützen, wie die französischen Truppen vermuteten? Im Mai hatte Napoleon dort eine Armee der Russen und Preußen vernichtet. Er kannte sich aus.
Es wurde nichts davon. Vom 16.?Oktober 1813 an wütete die Schlacht über vier Tage bei Leipzig. Genauer: um Leipzig herum. Man kann nicht von einem einzigen Schlachtplatz sprechen, sondern von zahlreichen verschiedenen Nestern, die einst um die Sachsen-Metropole herum verteilt waren und heute längst in ihr Stadtgebiet eingewachsen sind: Paunsdorf, Meusdorf, Möckern, Gohlis, Wahren?- und so fort. Nur Taucha, Markkleeberg und Schkeuditz sind noch eigenständige Gemeinden.
„Nie hat es in Deutschland mehr Tote in so kurzer Zeit gegeben."
Als ein Ring aus Feuer, Lärm und Pulverdampf legt sich die Schlacht um die Stadt, von der sie sich ernährt. Rund 33?000 Einwohner zählt Leipzig, wo Napoleon rund 200?000 Soldaten zusammenzieht. 200?000! Das ist der Ausnahmezustand für eine vergleichsweise kleine, aber überdurchschnittlich reiche Stadt. Leipzigs Wirtschaftskraft war der Grund, der die Franzosen anzog. Napoleon wollte seine Armee versorgt sehen. Die setzt sich wie ein Parasit auf das Wirtstier, das noch Jahrzehnte brauchen wird, um sich von diesem Überfall zu erholen. Und die Landschaft rund um Leipzig, zu der auch Halle gehört.
Das vor allem heimatkundliche und folkloristische Gedenken an die Schlacht, der 100?Jahre darauf ein geschichtsklitterndes „Völkerschlachtdenkmal“ beschert wurde, macht vergessen, mit welchem Grauen man es mit der Schlacht von Leipzig zu tun hat. Welchen Schrecken man freilegen müsste, um dem Geschehen einigermaßen gerecht zu werden.
„Nie hat es in Deutschland mehr Tote in so kurzer Zeit gegeben, nicht in der Varusschlacht, nicht bei der Erstürmung Magdeburgs im Dreißigjährigen Krieg, nicht bei den Bombenangriffen auf Hamburg oder Dresden im Zweiten Weltkrieg“, schreibt der in Leipzig und Frankfurt am Main lebende Publizist und Historiker Andreas Platthaus. „Die hunderttausend Toten, die nach den vier Tagen von Leipzig gezählt wurden, sind bis heute unerreicht geblieben.“
Respekt vor Napoleon zerbricht vor 200 Jahren
Platthaus, Feuilletonredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hat mit „1813?- Die Völkerschlacht und das Ende der alten Welt“ das Buch zum 200-Jahr-Gedenken geschrieben. Klug, umfassend und sinnfällig?- der Augenschein auf die Landschaft?ist immer dabei. Platthaus zeigt, was Napoleon von seinen Gegnern unterschied, nämlich, dass seine Herrschaft durchaus vom Willen des Volkes abhing, sehr im Gegensatz zu der des erblichen Adels.
Platthaus zitiert, was Napoleon im Juni 1813 dem österreichischen Außenminister Metternich erklärte: „Eure Majestäten, die auf dem Thron geboren sind, halten es aus, zwanzigmal geschlagen zu werden. Jedes Mal kehren sie zurück in ihre Hauptstadt. Ich bin nur der Sohn des Glücks. Ich würde von dem Tag an nicht mehr regieren, an dem ich aufhörte, stark zu sein, an dem ich aufhörte, Respekt zu erheischen. “
Dieser Respekt zerbricht heute vor 200 Jahren. Es ist ein Sonnabend inmitten einer Regenperiode. Noch der Morgen ist nass und neblig, bevor es gegen zehn Uhr und bis auf wenige Schauer am Nachmittag trocken bleibt. Platthaus lässt den 23-jährigen Jurastudenten Christian Gottlieb Schneider sprechen, der vom Dach eines Leipziger Bürgerhauses „mit Hilfe eines Tubus diesem furchtbar großen Schauspiel“ zusieht. „Ich konnte die Schlachtlinie beyder Armeen ganz übersehen, und jeden Kanonenschuss kündigte mir das der Mündung entstürzende Feuer voraus an.“ Einen Monat nach dem Gemetzel stirbt Schneider an Typhus, dem Tod nach der Schlacht. Wie der große hallesche Mediziner Johann Christian Reil: Er zieht sich bei der Behandlung der Leipziger Opfer die Typhus-Infektion zu, die ihn wenige Wochen darauf tötet.
Zusammengebrochene Brücken, ertrunkene Menschen, umgestürzte Wagen
Lassen sich mit Platthaus die großen Linien des politischen und militärischen Geschehens begreifen, so liefert der Sax Verlag einen Zeitzeugenbericht: Carl Bertuchs „Wanderung nach dem Schlachtfeld von Leipzig im October 1813“. Der Journalist und Schriftsteller ist der Sohn des großen Weimarer Verlegers und Unternehmers Friedrich Justin Bertuch. Drei Teile zählt das neu herausgegebene Buch: das Schlachtfeldbegängnis, eine Schilderung der Schlacht und den Versuch über eine „Kapelle der Eintracht auf dem Schlachtfelde“.
Was Bertuch am Leipziger Stadtrand sieht: zusammengebrochene Brücken, ertrunkene Menschen, umgestürzte Wagen, „ganze Leichenhügel und hohe Haufen von Gewehren“. Alles trug „das Gepräge der Zerstörung“, es „dünkte uns ein ungeheurer Schiffbruch auf festem Lande“. Das Schlachtfeld hingegen, über das die Leichenfledderer und Totengräber sofort hinweggegangen waren, sieht aufgeräumt aus. „Verhältnismäßig lagen mehr Pferde als Menschen da.“
Die Bilanz einer „Völkerschlacht“? Nein. Die „Völker“ hatten hier nichts zu melden. Das Gemetzel war, worauf Platthaus verweist, die letzte Schlacht feudaler Art, in der die Monarchen noch als Oberbefehlshaber selbst im Feld standen. In Waterloo, zwei Jahre darauf, war nur noch Napoleon zu sehen. Auch er zum letzten Mal.