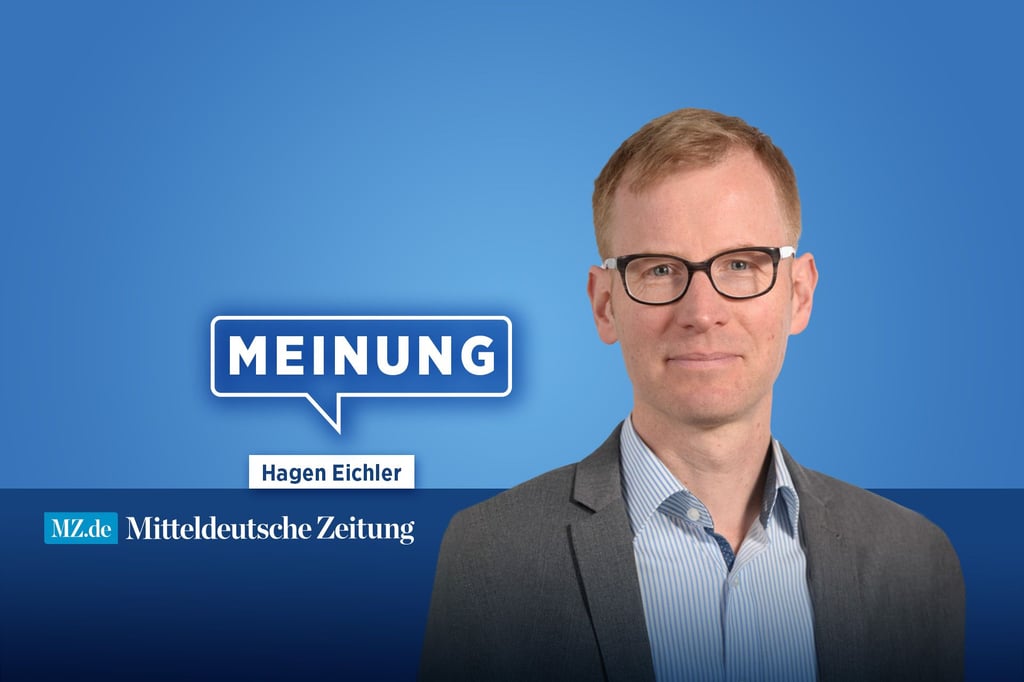Umweltforschung Umweltforschung: Vielfalt der Falter

Halle (Saale)/MZ - Spazierengehen im Auftrag der Wissenschaft: So könnte man die freiwillige Mitarbeit im sogenannten „Tagfalter-Monitoring“ (Monitoring englisch für Bestandsaufnahme) des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung Halle (UFZ) bezeichnen. Im April beginnt der neue Untersuchungszeitraum, der bis Ende September dauert. Auch Hobby-Wissenschaftler wie Familien, Senioren oder auch aus Schulen und Kindergärten können mitzählen - je mehr, desto umfangreicher die Datensammlung. Etwa 500 Freiwillige beteiligen sich bereits in Deutschland.
Einmal pro Woche ist entscheidend
Voraussetzung ist, dass man einmal pro Woche zur gleichen Uhrzeit die gleiche Strecke läuft beziehungsweise den gleichen Naturlebensraum (Transekt) untersucht. Und das Positive: nur bei gutem Wetter. Dadurch werden vergleichbare Daten gewonnen. „Daraus entstehen Zeitreihenanalysen, die Rückschlüsse auf die Entwicklung des Klimawandels und der Artenvielfalt zulassen können“, erklärt die Projektkoodinatorin Elisabeth Kühn . Im besten Fall erfolgt die Bestandsaufnahme über Jahrzehnte.
Die Forscher des UFZ sind üblicherweise mittwochs um 11 Uhr an den Brandbergen in Halle unterwegs. „Wir wollten ein Vorzeige-Transekt nehmen“, sagt Kühn. Die Brandberge seien nahe des UFZ gelegen und außerdem ein Naturschutzgebiet mit deutlich mehr Artenvielfalt als beispielsweise die Heide in Halle. In den Brandbergen gebe es eines der westlichsten Vorkommen an Trockenrasen und Feldvegetation sowie Porphyrfelsen - offenbar eine Umgebung, die vielen Schmetterlingsarten gefällt. Jeder wird per Strichliste gezählt. Wissenschaftliche Namen fliegen im Wechsel mit populärwissenschaftlichen Namen zwischen Elisabeth Kühn, Mitarbeiterin Birgit Metzler und Praktikantin Mirjam Seeliger hin und her.
Perfekt muss es nicht sein
„Es gibt festgelegte Standards“, erklärt Birgit Metzler: Für 50 Meter sind fünf Minuten Laufzeit angesetzt und jeweils 2,5 Meter rechts und links des Weges wird geschaut, ob sich dort Schmetterlinge finden. Die Wissenschaftler nutzen für die genaue Streckeneinteilung der Transekte GPS-Geräte. Voraussetzung sind sie für Laienwissenschaftler aber nicht. Ein Fernglas kann allerdings bei der Bestimmung einzelner Arten helfen, ebenso wie Fachbücher. Ist man sich unsicher, kommen das Fangnetz und eine Becherlupe zum Einsatz, um sich ein Tier aus der Nähe anzusehen. Fotos können ebenfalls nützlich sein. Allerdings müsse aufgrund der vielen gesammelten Daten nicht alles perfekt sein, ergänzt Elisabeth Kühn, um Freizeitwissenschaftler zu ermutigen, sich zu beteiligen.
Seit 1976 gebe es das Monitoring bereits in England, seit 1991 auch in den Niederlanden. In Deutschland hat das Helmholtz-Zentrum die fachliche Leitung über das Projekt, das 2005 gestartet ist. Mittlerweile ist das Monitoring ein Dauerprojekt, vorher war es über Drittmittel finanziert. Die Daten werden europaweit nach der gleichen beziehungsweise einer leicht abgewandelten Methode erhoben.
Trends erkennen
Im Umweltforschungszentrum erfolgt dann die Auswertung, die wie Kühn sagt „spannend und anspruchsvoll“ ist. Neben statistischen Korrekturen, um Begehungslücken aufzufüllen, werden auch Trends berechnet. „Das Problem ist, dass die Bestände aufgrund der natürlichen Entwicklung über die Jahre schwanken“, sagt Elisabeth Kühn. Daher könne man Trends nur über viele Jahre ablesen.