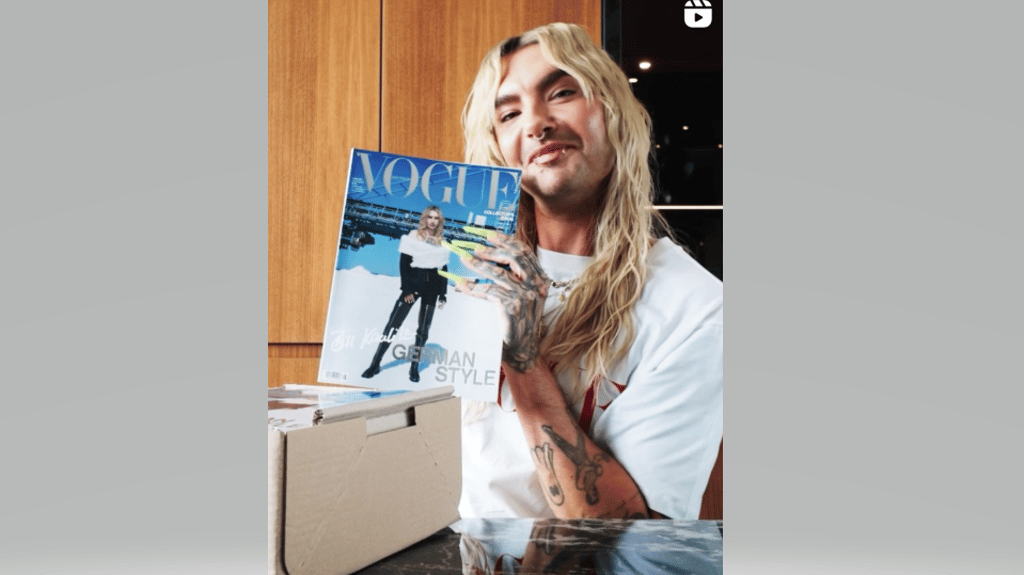"Mehr als Bettenbelegung" Tourismus 2017: Profitiert Sachsen-Anhalt vom Luther-Hype? Interview mit Wirtschaftsminister Armin Willingmann

Magdeburg - Luther bringt Schwung: Die neuen Tourismuszahlen stimmen Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) fröhlich - er hofft auf langfristige Wirtschaftsimpulse. Über den richtigen Umgang mit Investoren sprach er mit MZ-Chefredakteur Hartmut Augustin, Steffen Höhne und Jan Schumann.
Herr Willingmann, zum Kirchentag schauten Christen aus der ganzen Welt nach Sachsen-Anhalt. Was bleibt wirtschaftlich für das Land hängen?
Armin Willingmann: Der Kirchentag ist nur wenige Tage her, für eine wirtschaftliche Bewertung ist es sicherlich zu früh. Unser Ziel bleibt klar: Wir wollen, dass im Umfeld des Reformationsjubiläums so viele Menschen wie möglich nach Sachsen-Anhalt kommen.
Nicht nur in die Lutherstädte Wittenberg und Eisleben. Sie sollen Sachsen-Anhalt als Urlaubsland entdecken. Aber auch als Land, das sich für Unternehmens-Ansiedlungen eignet. Von Januar bis März sind die Übernachtungszahlen ausländischer Touristen um mehr als 17 Prozent gestiegen. Daher erwarte ich, dass wir aus diesem Jubiläum noch mehr herausholen können, als eine höhere Bettenbelegung.
Wirkt der Luther-Effekt nur in Wittenberg?
Willingmann: Die Zuwächse haben wir an den Lutherstätten, vor allem Wittenberg, und den Großstädten Halle und Magdeburg. Es profitieren also verschiedene Zentren des Landes. Nun setzt das ein, was wir uns für die Lutherdekade erhofft haben. Natürlich hätten uns den Effekt schon früher gewünscht, aber das Reformationsjubiläum ist nun einmal erst in diesem Jahr.
Und lockt das Luther-Label wirklich Investoren an?
Willingmann: Allein sicher nicht, es geht um so etwas wie einen „Beifang-Effekt“. Aber unter den Besuchern im Lande sind eben auch Geschäftsleute, die mitbekommen: „Mensch, hier gibt es Möglichkeiten.“ Außerdem haben wir nach dem Reformations-Veranstaltungen weitere Tourismus-Höhepunkte in den kommenden Jahren - etwa 25 Jahre Straße der Romanik oder das Bauhaus-Jubiläum. Auch da könnte man ja einwenden: Es ist doch nicht bewiesen, dass Leute, die sich für Kultur interessieren, automatisch Investitionsgelder mitbringen. Aber Chancen sind da, Sachsen-Anhalt insgesamt bekannter zu machen.
Aber selbst geplante Projekte wie die Seilbahn in Schierke stocken. Wie optimistisch sind Sie, dass das Projekt noch realisierbar ist?
Willingmann: Bereits Landesregierungen vor uns haben sich mit der Entwicklung in Schierke beschäftigt, in den letzten Jahren auch mit dem Seilbahnprojekt. Wenn Sie, so wie ich, neu in ein Amt kommen, müssen Sie klar machen, dass es für angelaufene Projekte keinen Paradigmenwechsel gibt. Schon gar nicht, wenn vorher Vertrauen erzeugt wurde. Selbstverständlich gilt aber auch, dass Genehmigungsverfahren ordnungsgemäß, also rechtsstaatlich ablaufen müssen. Dies muss man eigentlich gar nicht so oft betonen.
Eine Landesbehörde sieht rechtliche Probleme. Nun soll ein externer Gutachter kommen: Warum soll man ihm trauen?
Willingmann: Selbstverständlich besteht kein Misstrauen gegenüber Behörden. Aber es besteht auch keine Unfehlbarkeitsvermutung. In einem Verfahren, in dem es Streit gibt über die Einordnung von Gegebenheiten oder die Anwendung komplexen Rechts, finde ich es nicht falsch, einen Dritten um ein Gutachten zur Klärung dieser Fragen zu bitten.
Das dritte Gutachten zu dem Thema gilt dann aber wirklich?
Willingmann: Wir sollten uns in der Landesregierung darüber einig sein, dass es verbindlich ist. Wir können dann nicht mehr nach einem vierten, fünften Gutachten rufen.
Wie kann man dann sicherstellen, dass alle Beteiligten und Kritiker Vertrauen in dieses dritte Urteil bekommen?
Willingmann: Nicht alle Kritiker! Es geht jetzt um die Landesregierung – insbesondere die beteiligten Ministerien - weil es dort unterschiedliche Bewertungen gibt. Dritte, denen das Ergebnis nicht passt, mögen sich im Laufe des weiteren Verfahrens melden. Dafür gibt es den Rechtsweg.
Schon 2015 gab es im damals CDU-geführten Umweltministerium rechtliche Zweifel an den Seilbahnplänen. Wurde nicht seitdem Zeit verschenkt, um einen Sondergenehmigung bei der EU zu beantragen?
Willingmann: Aus heutiger Sicht muss man sagen: Ja! Das ist unglücklich gelaufen. Allerdings besteht nach wie vor eine Rechtsauffassung, dass man das allein über nationales Recht lösen könne.
Sie kennen die Investoren: Wie strapazierfähig sind sie?
Willingmann: Der Motor der Investorengemeinschaft, Gerhard Bürger, ist ein rüstiger Senior jenseits des 75. Lebensjahrs. Er hat zu verstehen gegeben, dass er das Projekt vollenden will. Vor dem Hintergrund glaube ich auch, dass weitere, längere Verzögerungen das Projekt gefährden werden. Das ist eine missliche Geschichte. Deshalb sage ich auch zur Ehrenrettung derer, die das EU-Verfahren damals nicht eingeleitet haben: Man hat damals gedacht, es geht nach bundesdeutschem Recht und damit schneller. Das war sicher auch der verständliche Versuch, den Investor zu halten.
Zu den großen Herausforderungen gehört der Lehrermangel. Wieso wollen Sie kein Zusatzgeld in die Lehrerausbildung an der Uni Halle stecken?
Willingmann: Die Universität hat jahrelang deutlich mehr Absolventen ausgebildet, als im Land eingestellt wurden. Es gab zu wenige Referendar- und Lehrerstellen. Entsprechend sind junge Menschen nach dem Lehramtsstudium scharenweise abgewandert.
Und das sind genau die Absolventen, denen wir jetzt hinterherlaufen. Wenn wir also eine insoweit verfehlte Personal-Politik korrigieren wollen, brauchen wir verlässliche Zahlen. Deswegen fange ich erst dann an, über erhöhte Studienplätze zu reden, wenn wir genau wissen, wie viele Referendar- und Lehrerstellen wir in den kommenden Jahren tatsächlich haben und unseren Absolventen anbieten können.
Macht sich der rote Teil der Koalition nicht einen schlanken Fuß? Mit Jens Bullerjahn und Stephan Dorgerloh waren zwei SPD-Minister zuständig.
Willingmann: Die Kenia-Koalition hat sich aus guten Gründen für einen Kurswechsel auch an dieser Stelle entschieden. Der Blick in den Rückspiegel nützt nur als Begründung, warum wir es heute besser machen wollen. Es geht also nicht darum, sich einen schlanken Fuß zu machen. Ich gehöre zu denen, die das Problem gerne lösen würden. Aber eben verbindlicher und im Interesse von Studierenden, Schülern und Lehrern, als es früher der Fall war.
Was wollen Sie tun?
Willingmann: Um dem akuten Lehrermangel zu begegnen: Die Universitäten in Halle und Magdeburg haben Vorschläge gemacht für Quereinsteigerprogramme. Diesen Lösungsweg finde ich richtig, ich kann mir eine ein bis zweijährige Zusatzqualifikation vorstellen. Beide Hochschulen sehen sich in der Lage, solche Programme kurzfristig aufzulegen. So könnten Menschen mit akademischem Abschluss eine Zusatzausbildung bekommen, um später als Lehrer zu unterrichten.
Das gilt für alle diejenigen, die einen naturwissenschaftlichen Abschluss haben, aber auch Geisteswissenschaftler. Aber auch hier ist wichtig, dass wir Planungssicherheit schaffen – auch für die Teilnehmer solcher Programme: Sie müssen eine sichere Chance auf Einstellung in Sachsen-Anhalt haben, wenn sie ein solches Programm erfolgreich absolviert haben. Nur dann kann man seriös dafür werben. (mz)