Ortschroniken digital Scannen gegen den Verlust - so retten Forscher und Bürger Sachsen-Anhalts Heimatgeschichte
Ortschroniken speichern die Geschichte eines Dorfes. Jedoch: Die Pflege dieser Bücher ist aufwendiger und lokale Historiker sind knapp. Ein Projekt der Uni will das Erbe retten. Im kleinen Harsdorf ist das bereits geschehen.
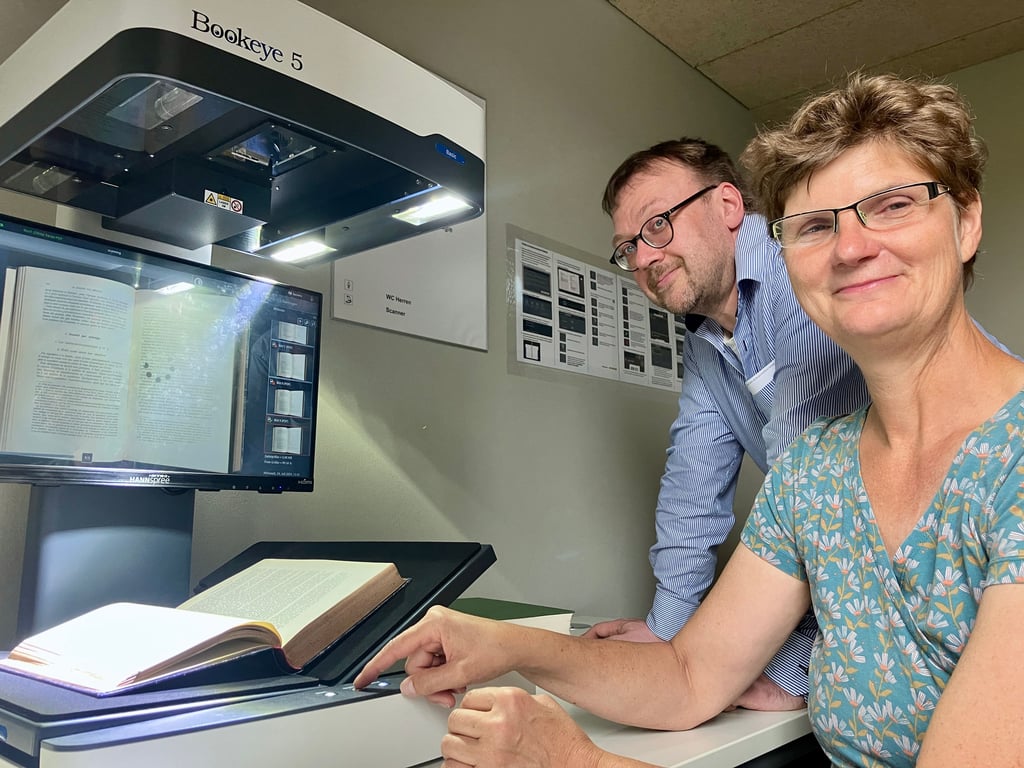
Halle/MZ. - Vielleicht war der Winter 1732 in Harsdorf besonders kalt. Übermittelt ist das zwar nicht, aber es gibt einen Hinweis. Denn in dem Dorf, das heute ein Teil Oppins ist und zur Stadt Landsberg im Saalekreis gehört, wurde um die Holzkasse gestritten. Die regelte, wer im Dorf welches Anrecht auf den Wald rundherum hatte. Und das musste, so scheint es, in Harsdorf neu festgelegt werden. Denn im Januar 1732 fing ein gewisser Major Rauchhaupt, der wohl so etwas wie ein Ortsvorsteher war, mit „allen vier Gemeinen einen Brozeß“ an. „Es gab also eine Verhandlung, in der die örtlichen Adeligen um Holzrechte stritten“, erklärt Michael Hecht. „Das war für das Dorf natürlich wichtig und deswegen landete es auch in der Ortschronik.“





