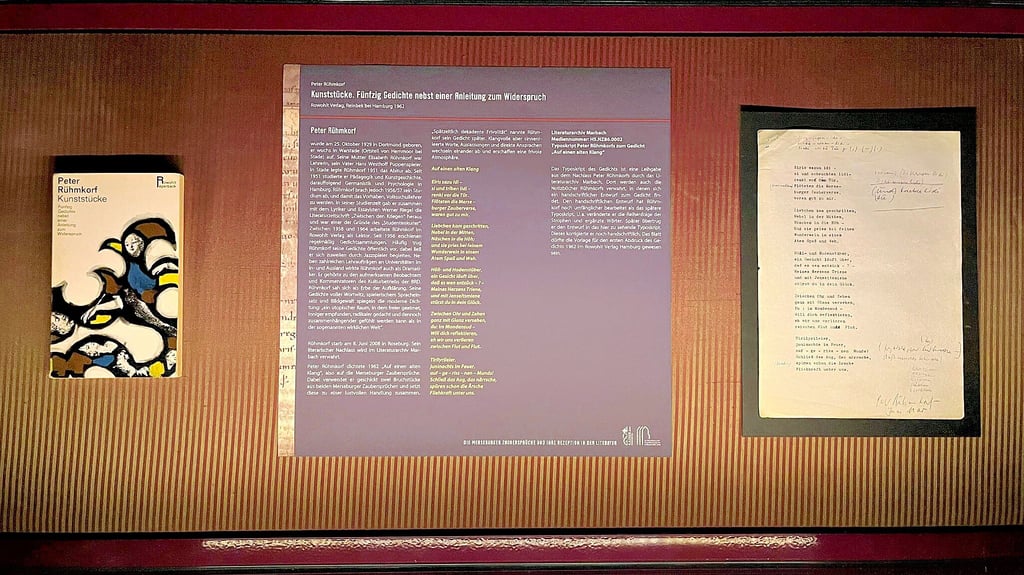Leipzig zu DDR-Zeiten Leipzig zu DDR-Zeiten: Werkstatt der Revolution

Halle (Saale) - Es ist ein hübsches Bild, das Martin Jankowski gefunden hat für den wilden Leipziger Osten am Ende der DDR: „Hier war die Küche, in der Innenstadt wurde serviert.“ Der Schriftsteller, Jahrgang 1965, stand damals mittendrin in der Küche. Gut vernetzt in der Opposition, mit Wohnung in Volkmarsdorf, östlich des Hauptbahnhofs, unweit der Eisenbahnstraße. Jene Straße, die dank eines Privatsenders in den Köpfen vieler heute fest verankert ist als „schlimmste Straße Deutschlands“, nach Schießereien im Bandenmilieu. Wo arabische Gemüseläden und türkische Kulturcafés zum Straßenbild gehören, aber auch offener Drogenhandel.
Der Leipziger Osten. Heute gilt das Viertel den einen als aufstrebend, den anderen als verrufen. Damals, 1989, war hier die Keimzelle der friedlichen Revolution gegen das SED-Regime. So sagt es Tobias Peter. Der Politologe hat zu dem Thema geforscht und mit seinem Team jetzt eine kleine, feine Ausstellung zusammengestellt.
Immer alles öffentlich machen
Im Osten haben sich Oppositionsgruppen vernetzt, sind Transparente gemalt und Flugblätter gedruckt worden für unzählige Aktionen schon vor dem Herbst 1989. Selbst in Leipzig wissen das wenige. „Die öffentlichkeitswirksamen Bilder gibt es von der Nikolaikirche und von den Montagsdemos“, sagt Peter, 37. „Deshalb hat kaum jemand den Osten auf dem Schirm.“
Wenn man die Geschichte des Leipziger Ostens als Revolutionswerkstatt erzählen will, kommt man um Christoph Wonneberger nicht herum. 1985 kommt er als Pfarrer an die Lukaskirche in Leipzig-Volkmarsdorf. In seiner Dresdner Weinbergsgemeinde hat er zuvor offene Jugendarbeit gemacht und versucht, DDR-weit einen „sozialen Friedensdienst“ als Alternative zum Wehrdienst zu etablieren. Wonneberger ist unbequem, er eckt an, und das gerne. Sein Motto: Immer alles öffentlich machen.
26 Jahre später sitzt er in seiner Wohnung im Zentrum von Leipzig. Er serviert grünen Tee, auf dem Tisch leuchtet eine Kerze. „Es gehört doch zur Aufgabe eines Pfarrers, offen zu reden und die Dinge beim Namen zu nennen“, sagt er. In Dresden ist er mit diesem Selbstverständnis damals nicht nur mit dem Staat in Konflikt geraten, sondern auch mit seiner Kirche. In Leipzig ist das nicht anders. Dass er 1987 eine Arbeitsgruppe Menschenrechte gründet, sieht die Kirchenleitung nicht gern. Dennoch koordiniert Wonneberger die Friedensgebete in der Nikolaikirche, die später vor allem mit seinem Kollegen, dem mittlerweile verstorbenen Pfarrer Christian Führer, in Verbindung gebracht werden.
Weitere Informationen zum Thema finden Sie auf Seite 2.
In Volksmarsdorf trifft Wonneberger, heute 71, auf Verfall und Widerstand. Der Staat hat begonnen, ganze Straßenzüge abreißen zu lassen, es ist laut und dreckig. Viele, vor allem Familien, sind schon weg, nach Grünau in die Platte. In leer gezogenen Altbauwohnungen bringen die Behörden ehemalige Sträflinge unter und Menschen, die aus ihrer Sicht nicht der Norm vom sozialistischen Staatsbürger entsprechen, im DDR-Jargon Asoziale. Es sind Umstände, die auch viele junge Leute anziehen, Studenten. Schwarzwohnen, das Besetzen zum Abriss vorgesehener Häuser, steht hoch im Kurs. Der Boden ist bereitet, aus dem Opposition wachsen kann.
Ein Haus besetzen: „Anders konnte man praktisch keine Wohnung bekommen“, erinnert sich Gesine Oltmanns, damals Anfang 20. Geboren im Erzgebirge, will sie in Leipzig Biologie studieren, bekommt aber keinen Studienplatz. Mit ihrem Freund wohnt sie in der Mariannenstraße 46, Erdgeschoss. Drei Zimmer, nasse Wände, kleine Kohle-Öfen, Klo übern Hof. So sieht es in vielen der leer gezogenen Wohnungen aus. Heute ist die „Marianne 46“ hübsch saniert, helle Fassade, Stuck. Damals gilt sie als Widerstandsnest. Hier und in anderen besetzten Häusern werden Aktionen geplant. Die Aktivisten setzen dem staatlichen Gedenken an Rosa Luxemburg eine eigene Demo entgegen. Sie organisieren einen Umzug entlang der verdreckten Pleiße als Mahnung an Umweltsünden oder ein Straßenmusikfestival in der Innenstadt.
Immer mitten drin im Zentrum des Widerstands: Christoph Wonneberger. Bei ihm koordinieren Friedensgruppen republikweit ihre Arbeit. Er bietet oppositionellen Musikern wie Stephan Krawzczyk eine Bühne. Sich selbst bringt er das Siebdruckverfahren bei; die Ausrüstung kauft und baut er sich zusammen. So können in der Lukasgemeinde heimlich Flugblätter gedruckt werden. Vier, fünf Leute wissen davon, mehr nicht.
Seiner Kirchenleitung wird der Pfarrer zunehmend zu aufmüpfig. Ende August 1988 bekommt Wonneberger einen Brief von seinem Superintendenten Friedrich Magirius: Von der Koordination der Friedensgebete, an denen sich auch Oppositionsgruppen beteiligen, ist er ab sofort entbunden. Der Mentor der Revolution - ausgebremst. Doch er will sich nicht den Mund verbieten lassen. Drei Monate später der Kompromiss: Wonneberger darf weitermachen, aber nicht alleine. Ihm werden drei Kollegen zur Seite gestellt.
Aber der Konflikt schwelt weiter. Juli 1989, Kirchentag der sächsischen Landeskirche in Leipzig. Politische Themen finden nicht statt, auf Druck des Staates. Wonneberger organisiert deshalb seine eigene Veranstaltung - den „Statt-Kirchentag“ in seiner Gemeinde. Er wird zum Forum von Oppositionsgruppen. Es ist einer dieser Momente, in denen Gesine Oltmanns befürchtet: Das war es jetzt. Mit anderen stellt sie für den Statt-Kirchentag eine Fotoausstellung zusammen. Die Infotafeln müssen sie quer durchs Viertel in die Lukaskirche bringen. Zu Fuß. Schließlich stehen sie vor der Kirchentür und warten auf den, der die Schlüssel hat. „Da dachte ich: Jetzt kommt gleich jemand und kassiert das ein.“ Aber alles geht gut.
Die Sprache verloren
Nicht so zwei Monate später: 4. September 1989, Nikolaikirchhof. Erstmals wagen sich die Teilnehmer der Friedensgebete aus dem Schutz der Kirche auf die Straße. Gesine Oltmanns und ihre Freundin Katrin Hattenhauer stehen ganz vorn. Sie tragen das Transparent, das sie am Abend zuvor gepinselt haben: „Für ein offnes Land mit freien Menschen.“ Eine Provokation für den Staat. Sekunden später reißen Stasi-Leute das Transparent herunter und laufen damit weg. Ein Team der ARD, zur Messe in der Stadt, filmt die Szenerie. Abends sind die Proteste von Leipzig in der Tagesschau.
Eine Woche später, die West-Journalisten sind alle wieder weg, greift die Staatsmacht durch. Jetzt wird auf dem Nikolaikirchhof wahllos verhaftet. Katrin Hattenhauer kommt ins Gefängnis. Gesine Oltmanns hat Glück, sie bleibt frei. Wie auch Christoph Wonneberger. Trotz mehrerer Vorgänge, die die Stasi über ihn anlegt, trotz der innerkirchlichen Konflikte - die Kirche bleibt sein Schutzraum.
Doch vor dem Zusammenbruch kann auch sie ihn nicht schützen. Am 30. Oktober, als Montag für Montag schon Zehntausende auf dem Leipziger Ring demonstrieren, erleidet Christoph Wonneberger, gerade 46, einen Schlaganfall. Der Mann des Wortes verliert mit einem Mal seine Sprache. Erst Jahre später wird er sie wiederfinden.
Groll darüber, plötzlich nicht mehr dabei sein zu können in den wilden Wendetagen, nein, sagt er, Groll habe er nie verspürt. „Ich war viel zu beschäftigt damit, in den Alltag zurückzukehren.“
Ausstellung „Alle unsere Träume“: Pögehaus, Hedwigstraße 20, Leipzig, bis 20. November
Im Internet: www.alle-unsere-träume.de