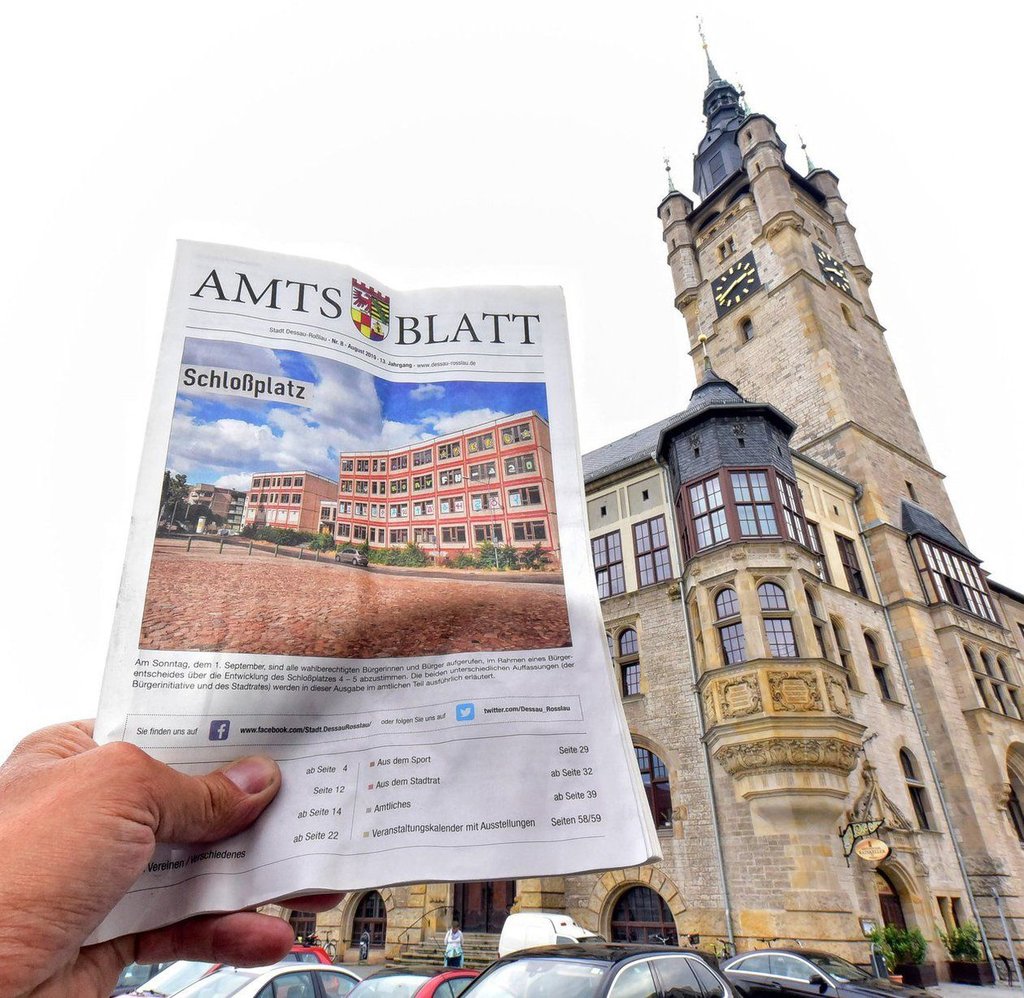Frau des Weltuntergangs-Pfarrers Frau des Weltuntergangs-Pfarrers: Frau Stifel Vorname "Witwe"

Wittenberg - Das Leben der Frau, um die es diesmal geht, liegt größtenteils im Dunkel. Es ist nicht einmal ihr Vorname überliefert. Sie wurde erstmals als Witwe des Lochauer Pfarrers Jakob Gropp erwähnt. Gropp hatte die Pfarrstelle im heutigen Annaburg 1516 erhalten. Seit 1520 zeigten viele Geistliche ihr Bekenntnis zur Reformation, indem sie heirateten. Frau Gropp ist vor der Eheschließung vielleicht seine Köchin gewesen. Aber das ist Spekulation.
Immer ein Risiko
Zur Erklärung und Einordnung: Existenziell bedrohlich konnte das Bekenntnis zur neuen Lehre besonders für Frauen werden. Wagten sie, einen ehemaligen Mönch oder Priester zu heiraten, begaben sie sich in eine gefährliche soziale Situation. Wie stand die Gemeinde zur Ehe ihres Geistlichen?
Beobachtung, Gerüchte, Beschimpfungen und dergleichen begleiteten von nun ihr Leben. Dazu kam die wirtschaftliche Unsicherheit. Pfarrer auf dem Lande erhielten einen Großteil ihrer Einkünfte in Naturalien. Um mit ihren wachsenden Familien zu überleben, bewirtschafteten sie gemeinsam mit ihren Frauen das Pfarrland mit Äckern, Gärten und Vieh.
Das alles war für die meist aus bürgerlichen Kreisen stammenden Frauen nicht immer leicht. Die Katastrophe kam, wenn der Gatte starb. Dann verlor die Frau gemeinhin alles – auch Haus und Hof – und blieb mit den Kindern mittellos zurück.
Jakop Gropp erscheint 1520 zweimal im Briefwechsel Luthers mit Spalatin. Am 25. März 1520 schrieb Luther: „Unterrichte den Pfarrer zu Lochau, daß er die Sitten des Hofes zu ertragen lerne, die der Herr ihm als Reliquien des heiligen Kreuzes bestimmt hat, und daß er nicht leichtfertig weichen soll. So wird er in diesem Dienst unbehelligt bleiben. Ich weiß, daß es sehr schwer ist, aber je ungestümer das Feuer ist, um so schneller und deutlicher prüft es das Gold.“
Der unglückliche Pfarrer Gropp könnte zu diesem Zeitpunkt schon verheiratet gewesen sein, denn seine Witwe heiratete mit Unterstützung Luthers Gropps Nachfolger im Pfarramt Dr. Franz Günther.
Die nunmehrige Pfarrfrau Günther brachte am 16. April 1522 einen Sohn zur Welt, der am folgenden Tage von Spalatin auf den Namen Franziscus getauft wurde. Patenschaften für das Pfarrerskind übernahmen neben Spalatin und dem Wittenberger Stiftsherrn Johann von Döltzsch sogar Kurfürst Friedrich der Weise. Doch das Baby starb noch am selben Tage. Frau Günther brachte in den folgenden Jahren noch zwei weitere Kinder zur Welt.
Am 3. September 1528 teilte Luther dem Kurfürsten Johann mit, dass der Hofprediger von Lochau, Franz Günther, gestorben sei. Günthers Frau war also erneut verwitwet und stand nun mittellos mit zwei Kindern da.
Pfarrwitwen-Konservierung
Amtsnachfolger Günthers wurde der Luther sehr nahestehende Michael Stifel. So verwundert es nicht, dass der Reformator den Freund am 23. Oktober 1528 selbst ins Amt eingeführt und am Folgetag Stifel mit der Witwe seiner Amtsvorgänger Gropp und Günther vermählt hat.
Stifel übernahm mit dem Amt, wie zuvor Günther, nicht nur die Gemeinde, sondern auch die Witwe, die Kinder, den Haushalt, die Landwirtschaft und so weiter seines Amtsvorgängers. Man nennt diesen Vorgang, der sich zu einem Gewohnheitsrecht entwickelte: „Konservierung“.
Pfarramtskandidaten, wie Günther und Stifel in Lochau, die sich durch die Ehe mit der Witwe ihres Vorgängers eine Pfarrstelle sicherten, konnten aus der Situation der Frauen Vorteile ziehen, denn die Pfarrwitwe brachte ihr komplettes Inventar in die Ehe ein und der Nachfolger konnte ein fertig ausgestattetes Pfarrhaus beziehen.
Sie hatte alle Erfahrungen für die Tätigkeiten einer Pfarrfrau in seiner Gemeinde und im Pfarrhaushalt. Zudem war sie firm in der Erzeugung und Verarbeitung der für die Familie notwendigen Lebensmittel bis hin zum Brauen des Bieres.
Die oftmals in erbärmlichen wirtschaftlichen Verhältnissen lebenden Pfarramtsanwärter konnten durch die Konservierung eventuelle Mängel in ihrer Ausbildung oder ihrem Examen kompensieren und dennoch eine Pfarrstelle erlangen.
Moralische Gründe wie Barmherzigkeit, Mitleid und Christenpflicht gegenüber der Witwe und den Kindern des Vorgängers sollte man ebenfalls für ihren Eheentschluss bedenken. Zudem waren Pfarrer ohne die Arbeit ihrer Ehefrauen wirtschaftlich nicht gesichert. Ohne das tägliche Brot kamen auch sie nicht aus.
Jeder hat von den Rechenkünsten Michael Stifels gehört, die 1533 zu seiner Schutzhaft in Wittenberg und in der Folge zu einer Odyssee durch Stellen in Holzdorf, in Ostpreußen, in Brück und zuletzt an die Universität Jena geführt haben.
Aber über das weitere Leben seiner Ehefrau und Kinder wird bisher nichts berichtet. (mz)