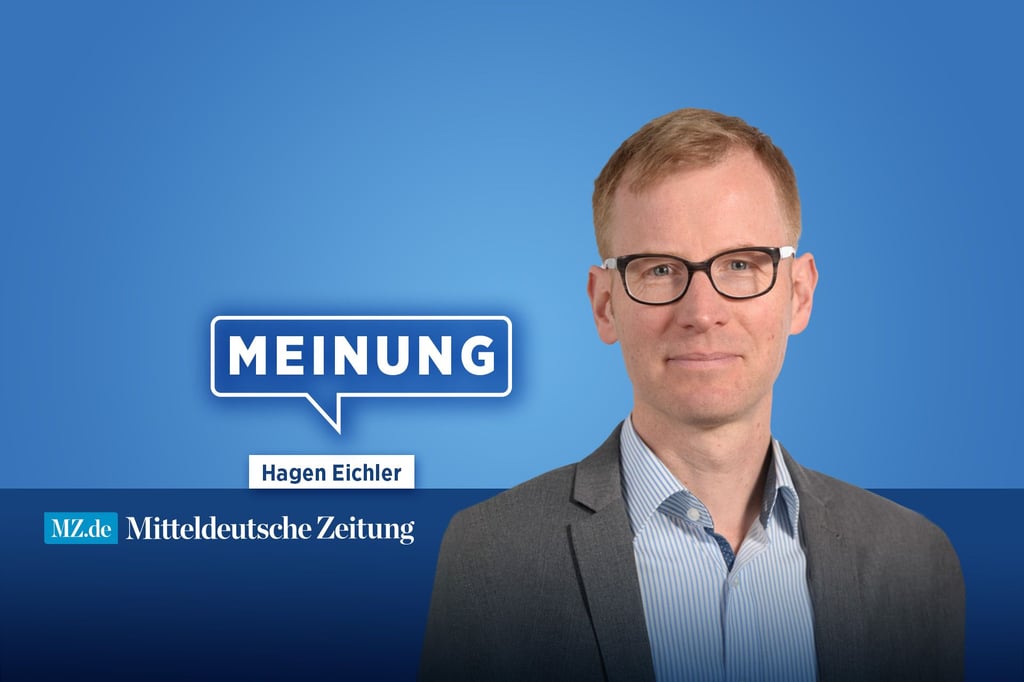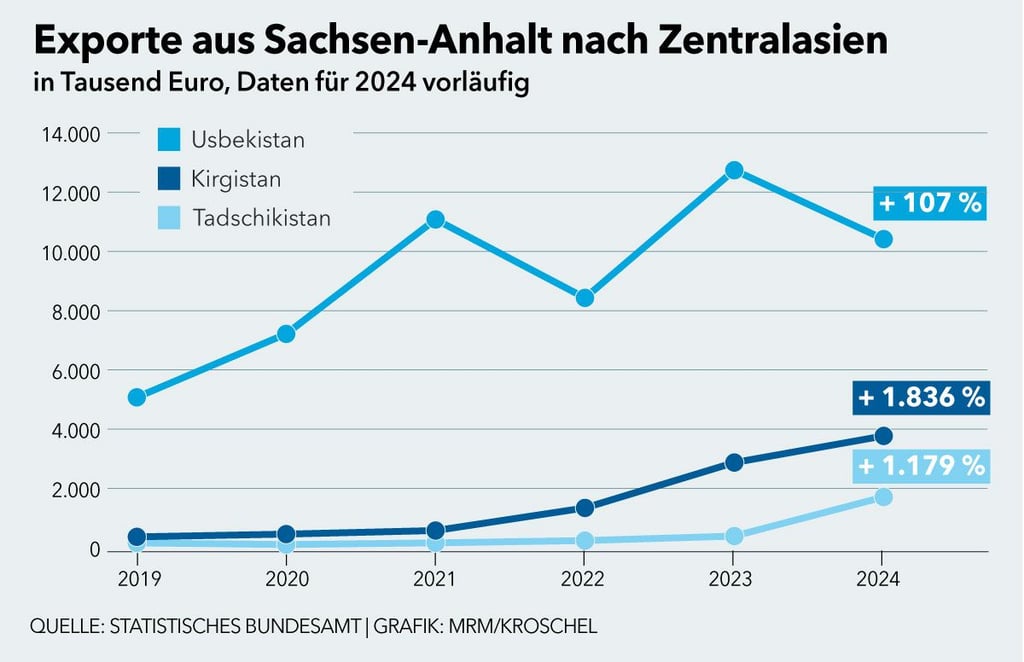Rückkehr zur Meisterpflicht Zurück zur Meisterpflicht im Handwerk: Was Handwerker im Raum Quedlinburg darüber denken

Quedlinburg - Die Bundesregierung rudert bei der Meisterpflicht ein Stück zurück: Für zwölf Handwerksberufe soll die 2004 abgeschaffte Regelung wieder eingeführt werden. Ein entsprechendes Gesetz soll bis zum Jahresende verabschiedet werden und Anfang 2020 in Kraft treten.
Dann können sich etwa Fliesenleger, Raumausstatter oder Orgelbauer nur noch nach bestandener Meisterprüfung selbstständig machen. Bestehende Betriebe genießen Bestandsschutz. Was halten Handwerker in der Region von der Wiedereinführung der Meisterpflicht?
Ein überfälliger Schritt - sagt der Geschäftsführer der auch für die Region Quedlinburg zuständigen Kreishandwerkerschaft Harz-Bode, Wulfhard Böker. Damit werde eine politische Fehlentscheidung zumindest zum Teil wieder korrigiert. 2004 wollte man in Berlin im Rahmen der EU-Politik den europäischen Handwerksmarkt in Teilen angleichen.
Die Liberalisierung von 2004 sei nach hinten losgegangen, sagt Wulfhard Böker von der Kreishandwerkerschaft
Die Idee, die Regelung, die es vergleichbar nur noch in Österreich und der Schweiz gibt, in Deutschland in zahlreichen Gewerken abzuschaffen, sei aber schließlich nach hinten losgegangen, meint Böker.
Als Beispiel nennt er das Fliesenlegerhandwerk. Hier habe sich die Zahl der Handwerksbetriebe dramatisch vermindert. Dafür hätten sich viele, die meinten, schon einmal gesehen zu haben, wie Fliesen verlegt werden, und glaubten, es auch zu können, etabliert. Meist sei dabei die Qualität auf der Strecke geblieben.
„Die sprichwörtlichen goldenen Hände allein reichen nicht“, sagt Böker. Und nicht zuletzt habe auch die Ausbildung gelitten, die nur von Meisterbetrieben geleistet werden könne. „Die wenigen Meisterbetriebe, die die vergangenen Jahre überstanden haben, gehen jetzt in Rente. Bleibt also die Frage, wer sich um die Ausbildung des Nachwuchses kümmern kann“, so der Geschäftsführer.
„Die sprichwörtlichen goldenen Hände allein reichen nicht“
Auch Orgelbaumeister Johannes Hüfken aus Halberstadt begrüßt die Wiedereinführung: „Ich finde, das ist ein notwendiger Schritt.“ So seien die Teilnehmerzahlen für Meisterkurse im Orgelbau seit der Abschaffung der Pflicht dramatisch eingebrochen. Es habe Überlegungen gegeben, den Lehrgang ganz einzustellen, so Hüfken. „Wissen mit einer langen Tradition drohte, verloren zu gehen.“
Seit 2004 sei zwar die Zahl der Betriebe im Orgelbau stark gestiegen, gleichzeitig sei jedoch weniger ausgebildet worden. Der Grund: Betriebe, die nicht von einem Meister geführt werden, können nur mit einer Sondergenehmigung ausbilden. „Mit der Freiheit hat man das Gegenteil von dem bewirkt, was beabsichtigt war.“
Die Neustarter der Branche hätten zusätzlich Preise und Qualität nach unten geschraubt - zum Nachteil von Kunden und Handwerkern. Andreas Thom, Fliesenleger- und Maurermeister aus Quedlinburg freut sich ebenfalls über die neue Meisterpflicht in seinem Gewerk. Er sieht darin vor allem die Qualität gesichert.
Neueinsteiger schraubten die Preise nach unten - und die Qualität, sagen Kritiker
„Es gibt viele Leute, die nur meinen, sie könnten Fliesen legen“, so Thom. Vielen Autodidakten fehlten jedoch wichtige Kenntnisse, etwa welches Fugenmaterial mit welcher Fliese verarbeitet werden darf. „Meister haben einfach ein anderes Fachwissen.“
Haiko Seiler betreibt seit über 20 Jahren einen Betrieb für Fliesen- und Fassadenarbeiten in Quedlinburg - er hat keinen Meistertitel. „In meinen Augen ist das Augenwischerei“, sagt Seiler. Er sieht darin eine unnötige bürokratische Hürde bei der Gewinnung des händeringend gesuchten Nachwuchses.
Nachdem er vor einigen Jahren mit einer Sondergenehmigung selbst ausgebildet hatte, habe die Handwerkskammer ihm das beim zweiten Mal verwehrt - weil er kein Meister ist. „Das zeugt von unnötiger Engstirnigkeit.“ Er sieht in dem Titel keinen Vorteil für die Ausbildung: „Glauben Sie, der Meister steht mit auf der Baustelle? Die eigentliche Ausbildung machen die Gesellen.“
„Auch Meisterbetriebe liefern manchmal schlechte Arbeit ab“
„Auch Meisterbetriebe liefern manchmal schlechte Arbeit ab“, findet Oliver Buchmann, selbstständiger Fliesenleger und Raumausstatter aus Harzgerode. Gutes Handwerk sei häufig eher eine Frage des Talents als des Titels. Seit 32 Jahren ist er in der Branche tätig, ebenfalls ohne Meistertitel.
„Nach der Ausbildung hatte ich einfach nicht das Geld für eine Meisterprüfung“, sagt Buchmann. Er plädiert für eine Meisterpflicht für größere Betriebe - etwa ab fünf Mitarbeitern. Sein Sohn ist derzeit in Ausbildung in einer anderen Firma. Denn selbst ausbilden darf Buchmann ihn nicht. „Das ist ein bisschen schade.“ Er will nun für seinen Sohn sparen, damit der einmal den Meister machen kann. (mz)