Interview mit einem Lachforscher Interview mit einem Lachforscher: Worüber lachen die Deutschen?
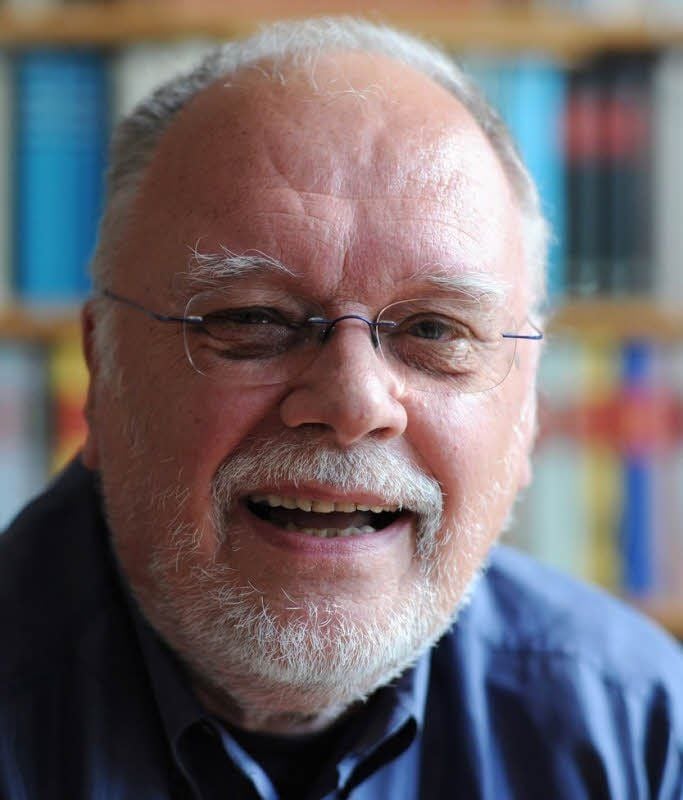
Halle (Saale) - Wer zuletzt lacht, lacht am besten? Oder hat er den Witz nur nicht schneller verstanden? Warum lachen wir? Und worüber? Und tun wir Deutschen das anders als andere Nationen? Rainer Stollmann ist Professor am Institut für Ethnologie und Kulturwissenschaft der Universität Bremen - und er ist Lachforscher. Mit ihm sprach Rainer Wozny.
Herr Stollmann, gibt es einen speziellen deutschen Humor?
Stollmann: Den gibt es, zum Beispiel Till Eulenspiegel. Bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts hat niemand den Deutschen eine besondere Ernsthaftigkeit nachgesagt. Der deutsche Ernst und die angebliche Humorlosigkeit sind eine Erfindung der Philosophie und der ernsten Musik im 19. Jahrhundert. Deutschland hat sich als Kulturnation verstanden, England als ökonomische Nation und die Franzosen verstanden sich als politische Nation. Wir hatten im zersplitterten Deutschland des 18. und 19. Jahrhunderts nur die Kultur des Bürgertums, das diese besonders ernst nahm.
Nirgendwo in Europa wird derart zwischen ernster und Unterhaltungs-Kultur unterschieden wie bei uns. In England gibt es diese Kluft gar nicht. Vergleichen Sie nur Shakespeare und Goethe und Sie werden sehen, wer lustiger ist. Im Grunde ist daran der verlorene Bauernkrieg schuld, nach dem sich das Bürgertum von den Bauern unterscheiden wollte. Die Bauern waren lustig, also musste das Bürgertum ernst daherkommen. Engländer und Franzosen hatten bei ihren Kämpfen gegen den Adel immer eine Koalition zwischen Bürgertum und Bauern, das hat letztendlich auch den Humor geprägt.
Krieg ist ein gutes Stichwort. Sie sind 1947 geboren. Hatte man in diesen Jahren damals etwas zu lachen?
Stollmann: Aber sicher doch. Zum Beispiel über Schwiegermutter-Witze. Nach dem Krieg gab es eine Überzahl an Frauen, da viele Männer gefallen oder noch in Kriegsgefangenschaft waren. Die Kriegsheimkehrer mussten also, wenn sie sich eine Frau suchten, die Schwiegermutter quasi gleich mit heiraten und mit ihr in den damals meist beengten Wohnräumen leben. Dort führten dann aber meist die Schwiegermütter das Regiment, und gegen diese Dominanz, gegen diese Angst halfen entsprechende Witze.
Hat der Deutsche heute genug zu lachen?
Stollmann: Die Deutschen haben nach dem Zweiten Weltkrieg gehörig aufgeholt. Nehmen Sie nur Loriot. Der kann sich mit allen englischen Komikern messen, ist dort aber völlig unbekannt. Das hat mit der Arroganz der Engländer zu tun zu meinen, man sei das witzigste Volk der Welt. Dabei hat Loriot starke englische Züge, er ist der höflichste Komiker der Welt. Im Streben, sich nach dem Krieg zu öffnen, hat man im deutschen Fernsehen – Ost wie West – große europäische Komiker gespielt: Luis de Funes, Monty Python etwa. In Frankreich oder England spielte man keine deutschen Komiker. So gesehen sind die Deutschen in Sachen Humor über die letzten 70 Jahre gebildeter als die Engländer und Franzosen. Wir haben aufgeholt, vielleicht auch deshalb, weil böse zu sein so anstrengend ist. Schauen Sie sich nationalsozialistische Gesichter auf Monumenten dieser Zeit an, da lacht nicht eines. Auf Seiten der Diktatur und autoritärer Kontrolle gab es kein Lachen. Lachen ist Anarchie, die ist in Diktaturen nicht zu Hause.
Lachen Ost- und Westdeutsche heute noch unterschiedlich?
Stollmann: Eine interessante Frage. Wahrscheinlich noch ein bisschen. Es würde sich lohnen, das durchaus mal genauer zu untersuchen. Die Traditionen des Humors sind andere, die Themen der Witze waren es auch. Das wirkt sicherlich noch nach.
Der Osten ist mit dem politischen Witz groß geworden. Er war damals ein Ventil für Frust. Wo ist der politische Witz heute hin?
Stollmann: Es gibt ihn fast nicht mehr. Und da, wo es ihn gibt, wird er immer dünner. Das hängt vermutlich mit der Veränderung in der Politik zusammen. Mal grob gesagt: Politik gibt es nicht mehr. Damit stirbt auch der politische Witz. Politik ist gerade jetzt in den Zeiten der Großen Koalition aufgegangen in Verwaltung. Alle treffen sich in einem großen politischen Mainstream, der wenig Ansatz für Witze bietet. Früher war es beliebt, mit Witzen auf Politiker „einzuprügeln“. Heute weiß man, dass die ja doch nicht so mächtig sind, das lässt keinen Raum für Witz. Würden Sie die Finanzkrise der letzten Jahre zum Witzthema machen, würden Sie merken, dass Sie die nicht personalisieren können. Das macht Witze schwierig.
Kann man am Lachen den Zustand der Gesellschaft bewerten?
Stollmann: Goethe sagt in den „Wahlverwandtschaften“: Sage mir, worüber du lachst, und ich sage dir, wer du bist. Je offener eine Gesellschaft ist, um so mehr lässt sie auch das Lachen über alles zu. Das abschreckende Beispiel fehlender Offenheit war der Nationalsozialismus, wo man praktisch nur über Judenwitze lachte. Ähnlich, wenn auch ein wenig anders, war es dann in der DDR mit politischen Witzen. Wenn eine Öffentlichkeit fehlt, in der man wirklich über existierende Probleme sprechen kann, dann flüchtet die Gesellschaft in den Witz und die Menschen verständigen sich mit Anspielungen. Das ist ein Ventil, das sich die Leute nicht werden nehmen lassen. Ich habe keine Ahnung, ob es in Nordkorea den politischen Witz gibt, aber in Europa war er immer da.
Kann man es mit dem Lachen übertreiben?
Stollmann: Durchaus. Die Süddeutsche Zeitung schrieb einmal vom „Terrorismus der guten Laune“. In Comedyshows wird zum Beispiel das Lachen eingespielt, das sind doch schon echte Dekadenzphänomene. Sogar der Tonfall auf manchen Radiosendern hat sich dem angepasst. Wenn ich so etwas höre, schalte ich weiter.




