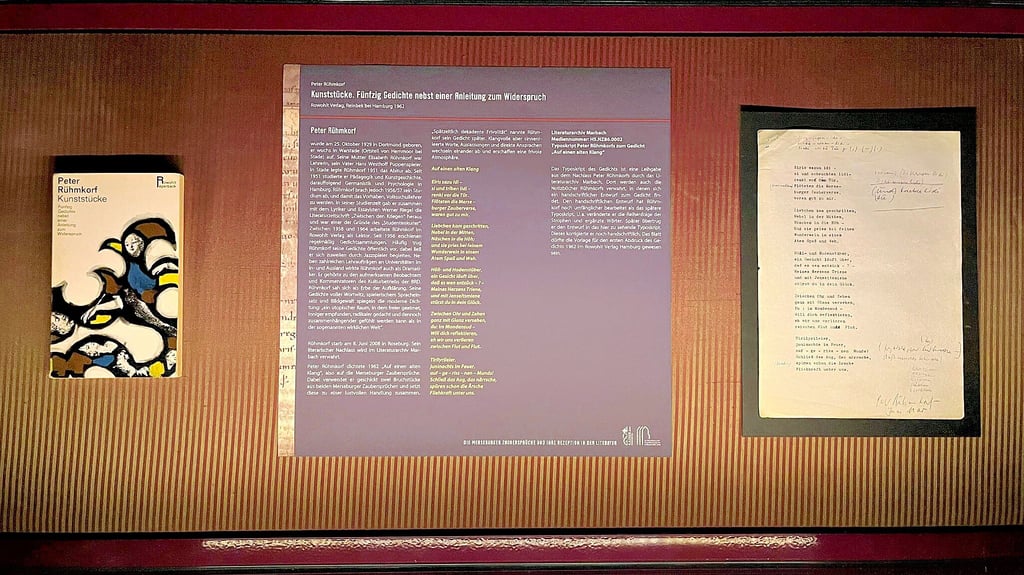Hochwasser in Mitteldeutschland Hochwasser in Mitteldeutschland: Waren Talsperren vorher zu voll?

Halle/MZ - Zentimeter sind es am Ende, die Sachsen-Anhalts größte Plattenbausiedlung in Halle-Neustadt vor dem Wasser retten. „Fünf mehr und wir wären erledigt gewesen“, sagt ein Feuerwehrmann. Drei, widerspricht ihm einer seiner Kollegen. Klar ist an diesem sonnigen Tag Anfang Juni, dass nicht viel Wasser fehlt, um aus der Jahrhundertflut eine echte Katastrophe auch für die größte Stadt im Lande zu machen. Bis zur Neustädter Stadtmitte würden die Fluten strömen, bräche der Gimritzer Damm. 30 000 Menschen müssten evakuiert werden, Bauschäden in Millionenhöhe wären zu befürchten.
Die Schuldigen sind anfangs ausgemacht: Die DDR-Bauplaner, die die größte Neubaustadt der Arbeiter- und Bauernrepublik mitten in ein natürliches Überflutungsgebiet gesetzt haben. Eine Bausünde wie so viele, die später begangen wurden. Doch der frühere hallesche CDU-Fraktionschef Eberhard Doege und spätere Dezernent in der Stadtverwaltung hat als einer der ersten noch einen ganz anderen Verdacht: „Schauen Sie sich doch mal das Talsperrenmanagement in Thüringen an“, sagt er, während das Wasser noch auf den Straßen steht. Zu DDR-Zeiten habe es komischerweise zwar Hochwasser gegeben, nie aber welche mit solchen Auswirkungen wie zuletzt. „Das fällt schon auf“, so Doege.
Nicht nur dem früheren Politiker. Auch im Internet wächst schnell ein ungeheuerlicher Verdacht: Der Stromversorger Vattenfall, der die Talsperren der sogenannten Saalekaskade bewirtschaftet, heißt es da, habe ein Interesse daran, vor der Trockenzeit im Sommer möglichst viel Wasser in seinem Staubecken zurückzuhalten, um möglichst lange möglichst viel Strom erzeugen zu können. Und dieses Interesse an einer vollen Talsperre treffe sich prima mit dem Interesse der thüringischen Lokalpolitik. Denn die fürchte nichts mehr als Sommerurlauber, die sich über gähnend leere Talsperren und fehlende Bademöglichkeiten im grünen Herz Deutschlands beklagen.
Talsperren, einst als Hochwasserschutzanlagen gebaut, verwandelten sich so immer mehr in rein kommerziell genutzte Bauwerke zur Trinkwassergewinnung und zum Erzeugen von Strom, kritisierten Bauern im Burgenlandkreis. Auch der hallesche Anwalt Heinz Schmerschneider hat eigene Berechnungen angestellt, nachdem ihm aufgefallen war, dass die schlimmen, die katastrophalen Hochwasser in Mitteldeutschland alle in den vergangenen 20 Jahren auftraten: „Ich kann mich an keine gravierenden Überschwemmungen an Elbe, Saale oder Mulde in DDR-Zeiten erinnern.“
Schmerschneider verweist auf die Staukapazität der sogenannten Saalekaskade von immerhin 400 Millionen Kubikmetern (siehe auch „Warum Fluten heute....“). Wenn allerdings vor Beginn der Regenzeit im Frühjahr schon viel Wasser in den Becken stehe, wie das in Thüringen der Fall gewesen sei, wo nur rund zehn Prozent der Staubecken für mögliches Hochwasser freigehalten werden müssten, führe das zwangsläufig zum Versagen des Hochwasserschutzes im Ernstfall. Das liege dann jedoch allein am „kollektiven Vergessen, dass Talsperren zum Hochwasserschutz errichtet worden sind“.
An der Neumühle in Halle ist es deutlich zu sehen: Die Flutmarken der Hochwässer aus den Jahren 1595 und 1799 liegen mehrere Meter über dem Höchststand, den die Saale im Jahrhunderthochwasser von 2013 erreichte. Dabei existierte seinerzeit noch kein Gimritzer Damm, kein Halle-Neustadt, das Wasser konnte sich damals also noch viel weiter ausbreiten als heutzutage. Dennoch stieg es damals nicht nur an der Neumühle, sondern auch an anderen Messstellen im ganzen Land viel höher als zuletzt.
Verantwortlich dafür, dass Hochwasser heute nie mehr die Flutmarken aus früheren Zeiten erreichen, ist im Fall der Saale vor allem das Saalekaskade genannte Sicherungssystem aus fünf Saale-Staustufen in Thüringen, die nach mehreren katastrophalen Hochwassern zwischen 1880 und 1890 konzipiert und in den 30er und 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gebaut worden waren.
Zur Gesamtanlage, die heute vom Energiekonzern Vattenfall Europe betrieben wird, gehören neben der Bleilochtalsperre und der Hohenwartetalsperre auch die kleineren Talsperren Burgkhammer, Walsburg, Eichicht und Wisenta. Die sechs Stauanlagen auf einer Strecke von rund 80 Kilometern können zusammen mehr als 400 Millionen Kubikmeter Wasser stauen.
Die Saalekaskade als Ganzes ist damit nach dem Schluchseewerk im Hochschwarzwald in Baden-Württemberg der zweitgrößte Verbund von Wasserkraftwerken in Deutschland. Die Bleilochtalsperre ist mit einem Fassungsvolumen von 215 Millionen Kubikmeter Wasser sogar der größte Stausee Deutschlands, Hohenwarte liegt mit einem Speicherraum von 182 Millionen Kubikmeter auf Platz 4. Vor allem die beiden großen Stauseen sind heute auch beliebte Naherholungsgebiete für Touristen.
Ein Vorwurf, den das Thüringer Landesverwaltungsamt nicht stehenlassen will. Die Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG) habe dem Talsperrenbetreiber Vattenfall „differenzierte jahreszeitliche Vorgaben zu den Talsperreninhalten“ gemacht, erklärt Sprecher Adalbert Alexy. Diese Vorgaben seien vor und während des Sommer-Hochwassers eingehalten worden. Auch der Vorwurf, Hochwasserschutz spiele heute eine weniger wichtige Rolle als früher, sei nicht zutreffend. „Die Vorgaben für das Saaletalsperrensystem sind seit August 1987 unverändert.“ Zudem habe das Land nach dem Hochwasser von 2002 neu festgelegt, wie der Hochwasserrückhalteraum der Saaletalsperren durch die TLUG zu bewirtschaften sei.
Damals wurde die für Bleiloch- und Hohenwartestausee vorgeschriebene Reserve von zusammen 25 auf 35 Millionen Kubikmeter im Sommer und von 43 auf 55 Millionen Kubikmeter im Winter erhöht. Unglücklich nur: Einen Monat vor der Sommerflut endete die Wintervorgabe. Knapp 20 Millionen Kubikmeter zusätzlich konnten nun aufgestaut werden. Der Betreiber habe hier allerdings keineswegs freie Hand: „Im Hochwasserfall erteilt die TLUG die Steueranweisungen zur Bewirtschaftung.“
Wie die Saaletalsperren, die vor Beginn der großen Flut ein wenig mehr Hochwasserrückhalteraum frei hatten, als sie nach ihren vorgegebenen sogenannten Stauzielen hätten haben müssen, waren Anfang Juni auch die Talsperren im Einzugsgebiet der Mulde keineswegs übervoll. Frank Meyer vom sächsischen Umweltministerium verweist darauf, dass in acht der zehn größten Stauanlagen jeweils mehr als zehn Prozent mehr Platz für zusätzliches Wasser war als vorgeschrieben. Auch die Stauwerke in Cranzahl und Sosa hätten mehr als fünf Prozent Luft zu ihrem Stauziel gehabt. Insgesamt betrage der Hochwasserrückhalteraum in den landeseigenen Talsperren und Rückhaltebecken Sachsen heute 162 Millionen Kubikmeter. „2002 war es ein Viertel weniger“, erläutert Meyer, „der zusätzliche Hochwasserrückhalteraum wurde durch Neubau von Anlagen und durch geänderte Bewirtschaftung geschaffen.“
Einen Zusammenhang zwischen geänderter Bewirtschaftung und vermehrten Jahrhundertfluten kann Frank Meyer sich nicht vorstellen. „Auch vor 1990 gab es Bewirtschaftungspläne, allerdings vielfach mit wesentlich geringeren Hochwasserrückhalteräumen und mit noch stärkerem Fokus auf Trink- und Brauchwasserbereitstellung.“
Trotzdem ereigneten sich die großen Fluten ausgerechnet seit der Wende, nämlich in den Jahren 1994, 2002 und 2013, hält Kritiker Heinz Schmerschneider dieser Darstellung entgegen. Alles Zufall? Alles nur der Klimawandel, die vermehrten Niederschläge? Auch hier ist die Faktenlage unübersichtlich: Nach einer Analyse des Institutes für Meteorologie der Uni Leipzig hat die Häufigkeit von Sommer- Hochwassern an der Elbe in den letzten 150 Jahren gar nicht zugenommen. In den letzten 30 Jahren herrschten nach einer Untersuchung von Andreas Schumann von der Ruhr-Uni Bochum sogar vergleichsweise vorteilhafte Niederschlagsverhältnisse.
Andreas Schumann sieht die Hochwasserschutzfunktion generell im Konflikt mit den anderen Nutzungen von Talsperren, denn sie brauche im Gegensatz zu ihnen „einen möglichst leeren Stauraum“. Doch selbst der könne nicht verhindern, dass das Talsperrensystem wirkliche Flutlagen nur dämpfen, weiträumige Überschwemmungen aber nicht verhindern kann.
Schumann weiß nicht, wann es regnet, wie lange oder wie viel, muss aber vorher reagieren, um nachher alles richtig gemacht zu haben. Für den Wissenschaftler ein auch theoretisch unlösbarer Konflikt: „Der Betreiber findet sich hier kommunikativ grundsätzlich in der Defensive, da er auf seine zum Zeitpunkt der Steuerung beschränkte Informationsbasis verweisen muss.“