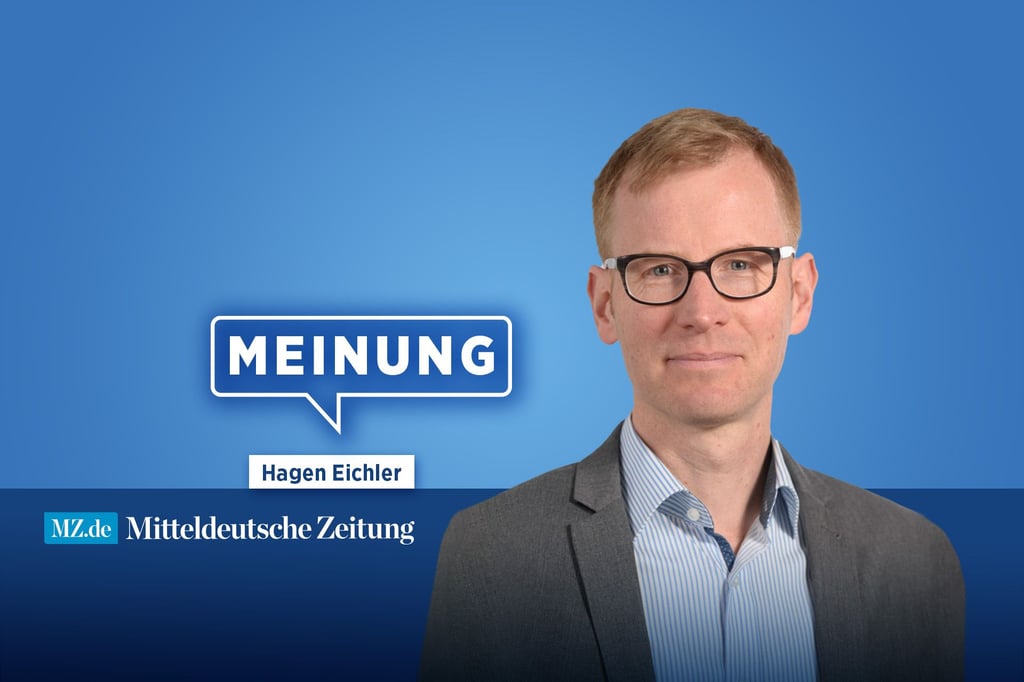Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig: Rühren und füttern - auch Mikroben haben Bedürfnisse

Leipzig/MZ - Sie sind winzig und haben oft nicht den besten Ruf. Dabei sind Mikroben kleinste Organismen, die deutlich mehr Potenzial haben, als nur „Keime“ zu sein. Am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig befasst man sich schon länger mit ihnen.
Mikroorganismen können beispielsweise als Brennstoffzelle mit Abwasser als Energiequelle Strom erzeugen und dieses dabei gleich reinigen. Oder sie können dazu genutzt werden, Fein- und Grundchemikalien wie Benzol oder Glycerol herzustellen. „Mit Nischenanwendungen in engen Produktgruppen ist allerdings erst in den kommenden zehn bis 15 Jahren zu rechnen“, sagt Falk Harnisch, Leiter der Forschungsgruppe Mikrobielle Bioelektrokatalyse und Bioelektrotechnologie am UFZ.
Einerseits geht es dabei darum, Möglichkeiten zu finden, Energie einzusparen oder besser nutzbar zu machen. Andererseits sucht man Wege, um vom Erdöl unabhängig zu werden, sagen Falk Harnisch und seine Kolleginnen Christin Koch und Carla Giemkiewicz. „Der Fokus verschiebt sich vom Abbau, beispielsweise Dekontamination, hin zum Aufbau, beispielsweise mittels Synthesen“, so Harnisch.
Mikroorganismen haben dabei Bedürfnisse, wie andere Lebewesen auch. „Wir müssen ihnen die Umgebung bieten, damit sie tun, was man möchte. Auch Mikroorganismen brauchen eine Wohlfühlumgebung“, sagt er. Dazu gehöre auch „rühren und füttern“. Aber man müsse die passenden Mikroorganismen zunächst finden, denn sie haben unterschiedliche Eigenschaften. Hat man sie gefunden, kann man - zumindest im Laborstadium - so einiges herstellen, beispielsweise Essigsäure aus Kohlendioxid. „Das zeigt, dass es im Prinzip geht“, sagt Harnisch. Nun werden auch hochpreisige Stoffe angegangen. Vor allem solche, die Erdöl ersetzen können, aus dem Kunst- und Kraftstoffe hergestellt werden. „Die weltweite Erforschung ist gesellschaftlich getrieben, um von Erdöl loszukommen“, so Harnisch.
Ebenfalls ökonomische Gründe hat es, energieeffizienter zu werden. So können Mikroorganismen wie Bakterien als elektrochemisch aktiver Biofilm auf einer Elektrode wachsen und mit ihr Elektronen austauschen. „Wir verwenden als Elektrode einen Graphitstab, weil es ein günstiges Material ist, das sich labortechnisch gut bearbeiten lässt“, erklärt Falk Harnisch. Die Elektrode und der Biofilm bilden dann ein sogenanntes mikrobielles bio-elektronisches System. Legt man eine Spannung an, kann man den Biofilm zwingen, etwas herzustellen. „So kann man aus einem Produkt wie Abwasser, was eigentlich Abfall ist, etwas Gutes machen“, sagt Wissenschaftlerin Christin Koch.
Methodisch sei seit dem Jahr 2000 mehr möglich. Es gebe bessere Untersuchungen und schneller Ergebnisse, ergänzt Christin Koch. Dadurch habe die Biotechnologie einen erheblichen Aufschwung erlebt. Das Wissen über einige Vorgänge ist teilweise seit 100 Jahren bekannt.
Zunächst gelte es allerdings, im Labor die Vorgänge zu verstehen und molekularbiologisch zu verstehen, „was drin ist“, bevor die Ergebnisse beispielsweise in Kläranlagen zum Einsatz kommen können. „Es ist spannende Grundlagenforschung“, sagt Falk Harnisch.
Mehr zur Forschung am UFZ unter:www.ufz.de