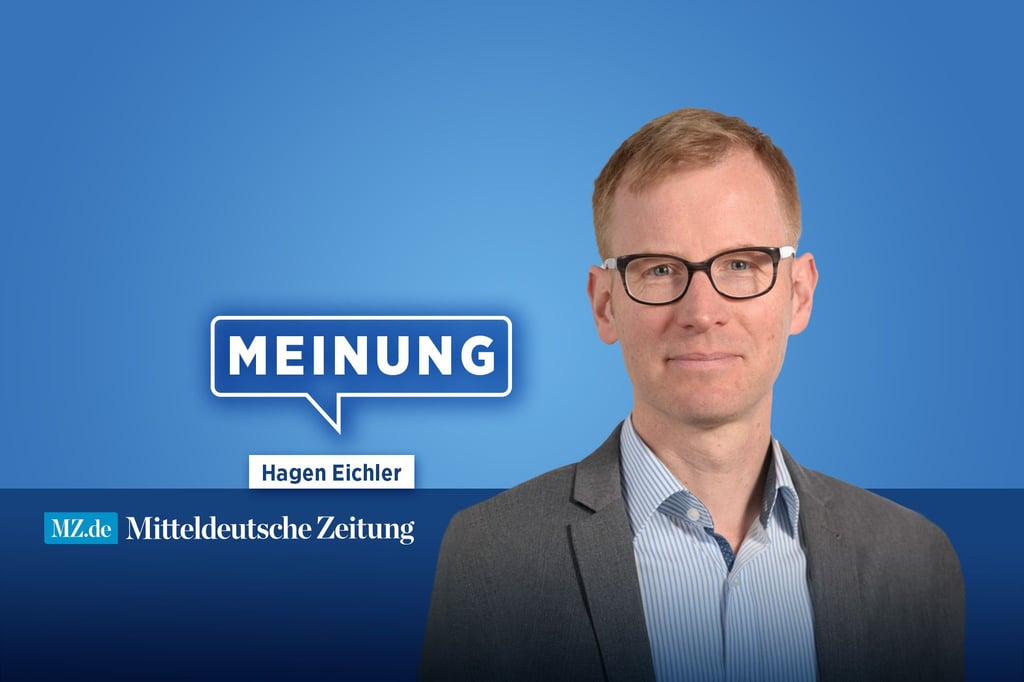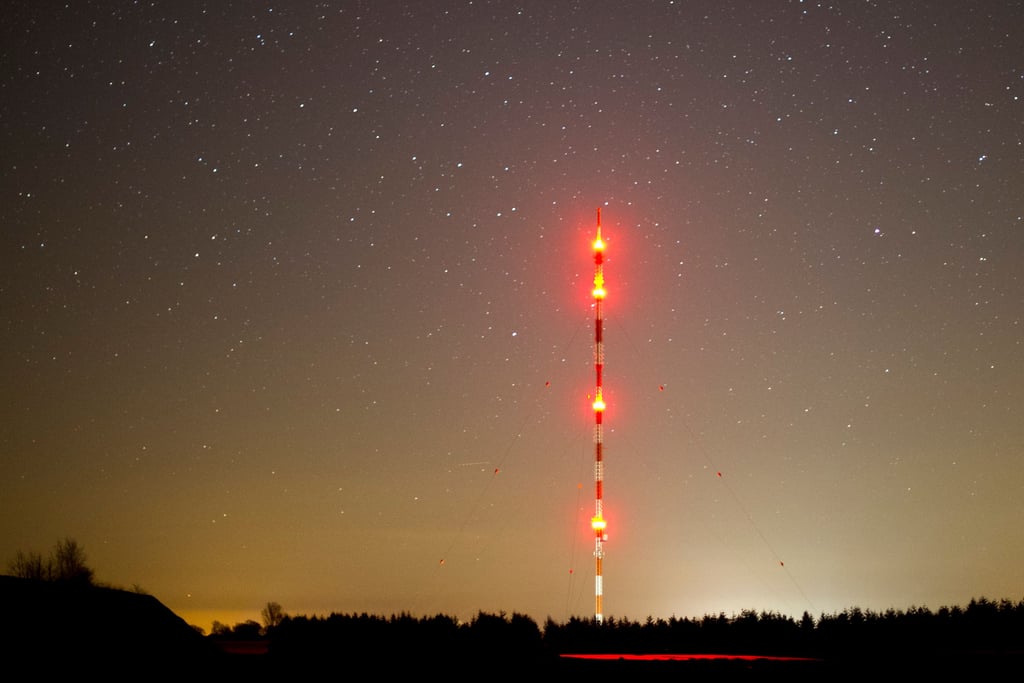200 Jahre Völkerschlacht bei Leipzig 200 Jahre Völkerschlacht bei Leipzig: Schau-Gefecht endet mit friedlichem Handschlag

Markkleeberg/MZ - Der erste Eindruck vor Ort hat quasi etwas Authentisches: Der Regen der vergangenen Tage hat - wie vor 200 Jahren - den Boden aufgeweicht. Wer in die Markkleeberger Weinteichsenke will und den neuzeitlichen Verkehrsstau oder das eher schlachtuntypische Anstehen am Eingang hinter sich hat, kämpft sich zum Teil über schlammige Wege zum Gefechtsfeld. Es hat Momente gegeben, da hätten es sich die Organisatoren der Gefechtsnachstellung fast ein bisschen weniger realitätsnah gewünscht: Bühnen mussten zweimal aufgebaut werden, weil sie im Schlamm zu versacken drohten. Die unter den Darstellern verpönten, weil völlig unauthentischen Handys funktionieren zur Schlacht selbst bei Händlern und Besuchern kaum: Das Netz hält den Massen nicht stand - Kommunikation wie anno dazumal.
Der Ansturm dürfte die Macher um den Verein „Jahrfeier Völkerschlacht bei Leipzig“ aber auch für einiges entschädigt haben: 27.000 Karten sind für das Spektakel im Vorfeld verkauft worden, mit 10.000 weiteren rechnen sie vor Ort. Am Ende ist das Interesse so riesig, dass die Eingangstore geschlossen werden müssen, als auf dem Feld gerade erste Dörfer geplündert werden, aber noch nicht ein Schuss zwischen Napoleons Truppen und den Alliierten fällt.
Wenig später versinkt Markkleeberg im Donner von Kanonen und Gewehren. 6.000 Uniformierte aus 26 Ländern stellen auf der rund 500.000 Quadratmeter (50 Hektar) großen Gefechtsfläche die Völkerschlacht nach - in einem Fall offenbar mit einem reellen Verwundeten, der ungeplant angeblich mit einem Bajonett verletzt wird. Die Darsteller kommen von weit her - ein Australier aus 16.000 Kilometer Entfernung. Und sie haben zum Teil schon Tage in historischen Biwaks verbracht wie Susanne Prestwood (62) aus England, eine Lehrerin mit deutschen Wurzeln. Sie ist Marketenderin, eine von vielen Frauen am Schlachtfeld. „Mich interessiert, wie die Leute gelebt haben, gekleidet waren, sich ernährten. Wie die Stellung der Frau war“, sagt auch Brunhilde Heberlein (78), Marketenderin aus Duisburg.
Draußen demonstrieren Kriegsgegner gegen das Spektakel. Dessen Organisatoren indes wehren sich gegen den Vorwurf, Militaristen zu sein und Krieg zu verherrlichen. „Man kann sich auch so Geschichte nähern“, sagt Vereinschef Michél Kothe - und erreiche mehr Leute als auf anderen Wegen, rege sie an, auch nachzulesen. Bei einem, der sich zuvor eher sporadisch mit der Völkerschlacht befasst hat, ist das definitiv gelungen: Karsten Ohme aus Glauchau hat sich den Roman „1813 - Kriegsfeuer“ von Bestsellerautorin Sabine Ebert zu Gemüte geführt, zuletzt jede Information aufgesaugt. Das wahre Elend der damaligen Zeit hat er im Hinterkopf, sagt er jetzt. „Aber so etwas hier sieht man eben auch nicht jeden Tag.“
Am Ende wird es doch noch besinnlich: Napoleon (ein Pariser Anwalt) und sein Widersacher Gebhard Leberecht von Blücher beenden die Schlacht anders als vor 200 Jahren per friedlichem Handschlag. Die Kirchenglocken der Region läuten. In einer Schweigeminute wird der Opfer gedacht. Rund 100.000 kamen damals ums Leben.