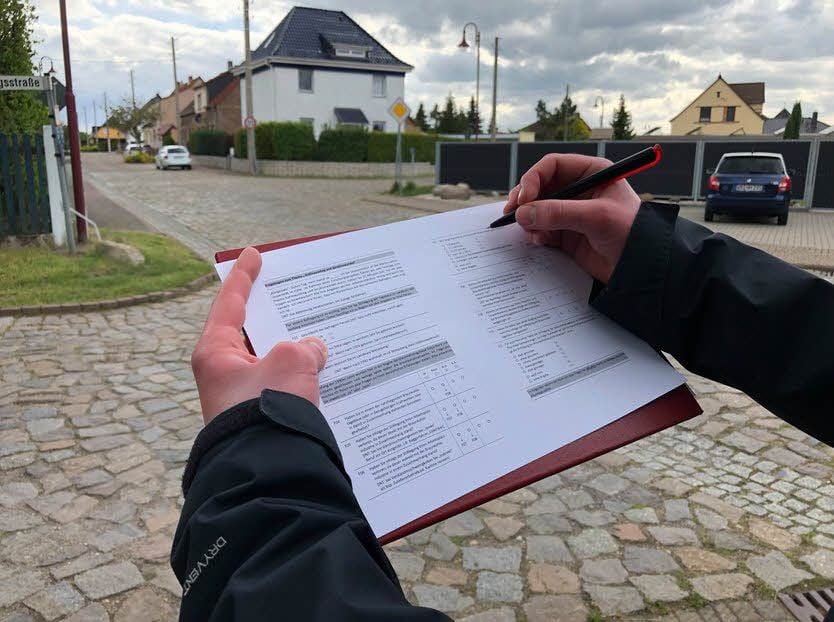Nach der Kohle Kohleausstieg: Ferropolis zeigt wie der Strukturwandel gelingen kann

Gräfenhainichen - Das Lied muss Hartmut Gawollek noch singen. Diesen Auftritt lässt er sich nicht nehmen. Deswegen stellt sich der 76-Jährige inmitten des Freilichtmuseums Ferropolis bei Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg) auf. Hinter ihm erheben sich riesenhaft die Bagger, die einst die Umgebung nach Braunkohle durchpflügten. Dann schmettert Gawollek los: „Glück auf, Glück auf“, schallt es durch die Stadt aus Eisen. Einige Ferropolis-Besucher wippen mit dem Kopf im Takt, manche singen sogar leise mit. Das Steigerlied ist hier bekannt. Es ist die Hymne der Bergmänner.
Lange gab es die Kohlekumpel auch in Gräfenhainichen. Gawollek war einer von ihnen. „Ich habe damals in der Zentralwerkstatt gearbeitet und die großen Bergbaumaschinen überall in der DDR zusammengesetzt“, sagt er. Der Betrieb, der einmalig im sozialistischen Teil Deutschlands war, beschäftigte in Hochzeiten fast 3000 Menschen. Im Kraftwerk Zschornewitz und den Tagebauen Golpa Nord und Gröbern, die rund um Gräfenhainichen lagen, kamen noch Tausende weitere Arbeiter hinzu. „Die Region lebte von der Kohle“, sagt Gawollek.
Doch Anfang der 90er Jahre war damit Schluss. Erst wurde Golpa-Nord stillgelegt. Dann folgten Gröbern und das Kraftwerk. Die Wäscherei mit ihren 50 Angestellten war plötzlich der größte Betrieb der Region. Das Steigerlied ist längst eine Hymne, die an Vergangenes erinnert.
Aus Erfahrungen lernen - Wie kam Gräfenhainichen von der Kohle los?
Gräfenhainichen und die umliegenden Orte sind bereits im Post-Kohle-Zeitalter angekommen. Und genau das macht sie nun so interessant. Seit vergangenem Freitag sind mehrere Studenten-Teams auf dem Gelände des Freilichtmuseums Ferropolis unterwegs. Einige haben Stift und Zettel dabei, andere Diktiergeräte und Kameras. Es sind Politik-Studierende der Uni Halle und angehende Designer der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Sie sind Teil eines Projektes, das den Strukturwandel in Gräfenhainichen untersuchen will.
Ins Leben gerufen wurde es vom Kompetenzzentrum Soziale Innovation, das zu Sachsen-Anhalts Sozialministerium gehört. Mitarbeiterin Mandy Stobbe betreut das Projekt. „Das Spannende hier in Gräfenhainichen ist, dass die Menschen den Transformationsprozess schon hinter sich haben“, sagt sie. Sie hätten erlebt, dass das, was zuvor Arbeit, Sicherheit und einer ganzen Region Zusammenhalt gab, auf einmal weg war. Und sie haben auch erfahren, wie es danach weiterging. „Deswegen kann man sie heute fragen, was beim Wandel ihrer Heimat schlecht lief - und was vielleicht auch gut“, sagt Stobbe.
Wird die Region Gräfenhainichen zum Vorbild beim Kohleausstieg?
Dieses Erfahrungswissen gewinnt aktuell wieder enorm an Wert. Denn mit dem beschlossenen Ende der Braunkohle-Ära begeben sich auch mehrere andere mitteldeutsche Regionen auf den Weg, den Gräfenhainichen schon beschritten hat. Bisher spielte diese Expertise bei Kohlekommission, Leuchtturmprojekten und Fahrplänen aber kaum eine Rolle. Das soll sich nun ändern.
Beim Ferropolis-Projekt nähern sich die Studenten auf verschiedenen Wegen den Transformationskenntnissen. Ein Team befragt ehemalige Bergleute wie Hartmut Gawollek. Es sind biografische Interviews, die deren Lebensweg vor, während und nach der Kohle nachzeichnen sollen. Diese Gespräche werden anschließend auch Teil einer Mobiltelefon-App, mit der Besucher sich die Zeitzeugeninterviews der Bergleute an verschiedenen Orten in der Stadt aus Eisen anschauen können. „Die Baggerfahrerin kann man dann vor ihrem Bagger erleben“, sagt Mandy Stobbe. Damit wird das Wissen der Bergleute auch konserviert.
Ein weiterer Weg, um den Strukturwandel nachzuzeichnen, ist, die Bevölkerung zu fragen. 15 Autominuten von Ferropolis entfernt, sitzt Armin Höpfner auf einer Bank. Um ihn herum sind Einfamilienhäuser und ein Spielplatz. Der Politik-Student befindet sich in Mescheide, einem Ortsteil von Gräfenhainichen. „Auch ländliche Gegenden der Stadt müssen in die Befragung einbezogen werden“, sagt Höpfner.
Kohleausstieg in Gräfenhainichen: Studenten befragen Bevölkerung
Der Hochschüler führt Interviews durch. Allerdings sind seine Gesprächspartner nicht vorher ausgesucht. Er geht wie ein Staubsaugervertreter mit einem Fragebogen bewaffnet von Haustür zu Haustür. „Bisher haben die Leute erstaunlich freundlich reagiert“, sagt Höpfner. Sie seien auch immer schnell ins Reden gekommen. „Das Thema ist eines, was die Menschen beschäftigt.“
100 Fragebögen wollen die Studenten zusammenbekommen. Höpfner hat zwölf geschafft. Wie hat sich ihr Leben durch das Aus der Kohle geändert? Waren sie von Arbeitslosigkeit betroffen und haben sie überlegt, die Region zu verlassen? Solche Betroffenheits-Aspekte werden von den Studenten erfragt. Allerdings geht es auch um die aktuelle Situation. „Wir wollen auch wissen, wie die Menschen die Energiewende sehen“, sagt Höpfner. Die Landespolitiker bekämen da derzeit ganz gute Noten. „Aber die Parteien kommen bei meinen Befragten ganz schlecht weg.“
Und eines, sagt Höpfner, würden die Menschen ihm gegenüber immer wieder äußern: Verwunderung. „Die sind erstaunt, dass die jetzige Transformation in den Braukohlegebieten schon vor dem Ende des Abbaus so generalstabsmäßig geplant wird.“ Bei ihnen hätte es das nicht gegeben. Da kam der Wandel einfach.
Ferropolis und Co: Strukturwandel verlief nicht geplant
Zurück nach Ferropolis, wo im Freisitzbereich der museumseigenen Gastronomie Thies Schröder Platz genommen hat. Er ist Geschäftsführer von Ferropolis und einer, der den Wandel in der Region seit Jahren begleitet. „Der Strukturwandel lief hier viel anarchischer und chaotischer.“ Es gab weder Fahrpläne noch eine bestellte Kommission. „Es war nur klar, dass der Tagebau ausgekohlt ist und saniert werden muss“, sagt Schröder. Das war es dann aber.
Schnell wurden zwar Pläne entwickelt, wie die gefluteten Tagebaulöcher zu touristischen Magneten gemacht werden sollten. Von Tausenden Arbeitsplätzen in Gastronomie, Hotels und Freizeitindustrie wurde geträumt. Sogar ein Unterwasserrestaurant in einem der neuen Seen war geplant. Doch obwohl das Wasser stieg, tauchte niemand zum Essen ab. Diese Hoffnungen erfüllten sich nicht. Viele Menschen verließen in der Folge auch die Region.
Einen strukturellen Wandel gab es trotzdem. „Der lief jedoch viel individueller ab“, sagt Thies Schröder. Jeder suchte sich seinen eigenen Weg in der Nach-Kohle-Ära. Das könne man an den Bergleuten gut sehen, meint der Ferropolis-Chef: „Ein Funkstreckentechniker hat zum Beispiel sein Wissen genutzt und ein Ein-Mann-Unternehmen aufgemacht, das bis heute gut funktioniert.“
Struktureller wandel nach Kohle-Aus lief hier individuell ab
Andere hätten ihre Kenntnisse im Stahl- und Metallbau in eine Existenzgründung gesteckt. Und Bergmann Hartmut Gawollek hat erst eine Videothek aufgemacht und dann, als seine Kunden mehr zum Trinken als zum Ausleihen kamen, eine Gaststätte eröffnet.
Das seien alles kleine Erfolgsgeschichten, meint Schröder. „Und aus ihnen kann man viel für andere Transformationen lernen - zum Beispiel, dass man den Menschen Raum geben muss, sich zu entfalten.“ Das zeige auch das Beispiel Ferropolis. Die Stadt aus Eisen ist weitaus mehr als nur ein Freilichtmuseum. Jedes Jahr finden dort auch vier große Festivals statt, die in der Region jeweils für Einnahmen in siebenstelliger Höhe sorgen. „Als Ferropolis Mitte der 90er Jahre geplant wurde, war der Festival-Trend aber noch gar nicht abzusehen“, sagt Thies Schröder. „Allerdings hat man uns genug Experimentierraum gelassen, dass wir uns in diese Richtung entwickeln konnten.“
Auch solche Erkenntnisse sind es, über die die Studenten berichten wollen. Nach der Materialsammlung vor Ort folgt das gesamte Semester über die Auswertung. Was dabei heraus kommt, soll im September in Ferropolis präsentiert werden. „Die Politik hat uns schon gesagt, dass sie sehr an den Ergebnissen interessiert ist“, sagt Mandy Stobbe. Sie wollen daraus lernen. (mz)