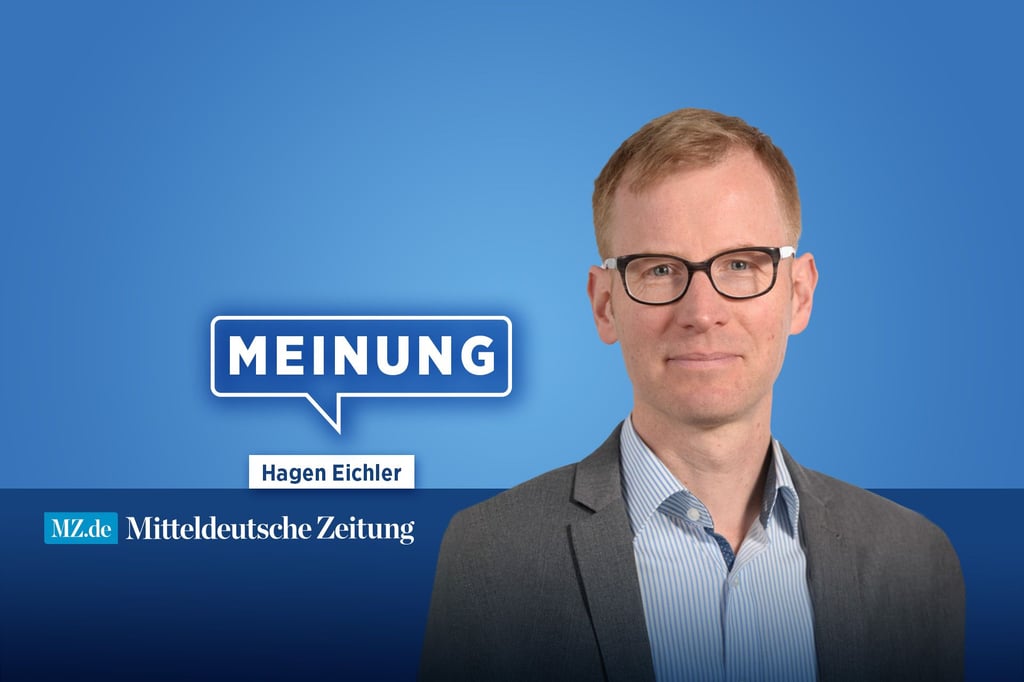Weimarer Klassik Weimarer Klassik: Warum Goethe für Gotha schwärmte

gotha/MZ - Es hätte alles ganz anders kommen können. Dann nämlich wäre Gotha statt Weimar zum Klassik-Hotspot geworden. Gesetzt den Fall, würden Goethe und Schiller dann in erhabener Denkmalspose womöglich vor Schloss Friedenstein aufs bildungsfrohe Touristenvolk blicken und statt des Nationaltheaters gälte der kleine feine Ekhof-Bau als 1-a-Musentempel für Faust & Co. Kurzum: Sämtliche Welterbe-Pilgerstätten wären dann einfach ein Stück weiter westlich von Weimar zu finden, runde 50 Kilometer nur, aber immerhin noch im deutschen Herzland Thüringen. Wobei die beiden Residenzen damals durchaus mehr trennte als die Entfernung.
Ein Kontrast, den Goethe sehr wohl zu schätzen wusste. Nicht umsonst hat er sich in drei Jahrzehnten immer wieder auf diesen Weg begeben. Den Gründen und Hintergründen für die über lange Zeit sehr enge Beziehung des Dichters zum Gothaer Hof geht Sigrid Damm in ihrem jüngsten Werk nach.
Sorgsam erkundete Welt
„Goethe ist mir in so vielen Gestalten nah“, hat die Autorin in ihrem autobiografischen Rom-Bericht „Wohin mit mir?“ festgehalten. Mit ihren Büchern hat sie sich dem Superklassiker immer wieder und von vielen Seiten genähert. Allemal ging akribische Forschung voraus, keine Fiktion, immer die sorgsam erkundete reale Welt. Allenfalls ein paar Gedankenspiele erlaubt sie sich.
So hat Sigrid Damm mit ihren Werken den Dichterheroen für ein großes Publikum aus dem fernen Olymp ein bisschen auf die Erde geholt. Goethe ganz privat. Nachzulesen in „Goethe und Christiane“, der Ehebriefsammlung „Behalte mich ja lieb“, Christianes Tagebuch und auch in „Goethe im Berg“, wo Damm den Dichter bei den ihm auferlegten prosaischen Tätigkeiten in Wirtschaft und Technik begleitet, bis hin zum Psychogramm von Alter und Abschied in „Goethes letzte Reise“.
Nun also Goethe und Gotha. Sozusagen ein Heimspiel für die Autorin. In Gotha wurde sie 1940 geboren, hier wuchs sie auf und wurde die erste Ehrenbürgerin ihrer Stadt. Sich auch hier auf die Spuren ihres „Lebens-Dichters“ zu begeben, war demnach fast schon eine Pflicht. Gelungen ist ihr dabei, manches auszugraben, was dem allgemein interessierten Publikum wie der versierten Kennergemeinde weitere Facetten Goethes ans Licht holt. Die Sache mit Gotha war da ja bislang ein weitgehend unbekanntes Kapitel. Sigrid Damm verhilft zu neuen Erkenntnissen, was Gotha für Goethe über lange Jahre so attraktiv gemacht hat. Von der Zeit, als der 19-jährige Student erstmals auf Schloss Friedenstein zu Gast war, über die jahrzehntelange Freundschaft mit dem Regenten Ernst II. (1745-1804) bis zum Erinnern im Alter war ihm die Nachbarresidenz stets nahe. Als der Ort, von dem er schwärmte, dass es ihm dort „so weich wie einem Schooskinde“ ergangen sei. Kein Wunder, wie man liest: „Man ist immer sehr freundlich und auf alle Weise gefällig gegen mich und ich tue das Meinige.“ Goethe, der Taktierer offenbart sich da, wie ihn auch Damm nüchtern benennt. Er hält sich eine Option offen.
Ein Ausweg aus den Weimarer Zwängen? Die bemängelt er unverblümt, wenn er schreibt, dass er von Gotha nach Weimar zurückkomme, „wo mich die Sorgen wie hungrige Löwen anfallen.“ Das ist der Punkt! Das, was Gotha für ihn bereit hatte und Weimar so schmerzlich seiner Dichterseele mit Pflichten verwehrte. Eine gewisse Leichtigkeit des Seins, ein Umfeld, in dem es sich unbeschwerter atmen ließ. Es ging dort deutlich lockerer zu.
Zwischen Pflicht und Neigung
Überhaupt, die Nachbarresidenz – sie leuchtete damals deutlich heller als die heute so berühmte Klassiker-Metropole. Herzog Ernst II. hatte diesen Glanz befördert. Ein Mann der Aufklärung, dem Kunst und Wissenschaft ebenso am Herzen lag, wie er Handwerk und Handel förderte. Kein Wunder, dass der von den Pflichten am Weimarer Hof genervte und in seinem künstlerischen Wollen behinderte Goethe nach einem Besuch nebenan dankbar vermerkte: „In Gotha ist es mir recht gut gegangen und es hat mir sehr wohl gethan meine Seele auch nur auf einige Tage ausgespannt zu haben.“
Was also hatte Gotha, was Weimar nicht hatte? Einen auch politisch aufgeschlossenen Souverän, zahlreiche Kunstwerke in großartigen Sammlungen, wissenschaftlichen Fortschritt unter anderem in der von Goethe interessiert verfolgten Astronomie, geistig anregende Begegnungen. In Weimar fühlt sich Goethe von höfischen Verpflichtungen und Geschäften zunehmend bedrängt. Es folgt die berühmte Flucht nach Italien, ins Offene, Freie – ohne „seinen“ Herzog groß zu fragen. „Von dort offeriert er beiden Fürstenhöfen seine Dienste“, liest man bei Sigrid Damm.
Goethe, der Taktiker, dem Beethoven mokant bescheinigte, dass ihm „die Hofluft zu sehr behagt“. „Unter dem strategischen Gesichtspunkt, die bestmöglichen Bedingungen bei seiner Rückkehr auszuhandeln“, wie zu lesen ist, findet er es sicher gut, zwei Eisen im Feuer zu haben. Ermutigt durch die komfortable Lage, von beiden Höfen umschwärmt zu werden.
Es hätte also wahr werden können. Goethe und im Nachzug der ganze Klassiker-Schwarm hätten Gotha statt Weimar geadelt. Kein so abwegiger Gedanke, folgt man den akribisch nachbereiteten Spuren der Affinität Goethes zu den Gothaer Nachbarn und Freunden.
Doch die Sache mit Gotha – sie ist anders gekommen. Goethe begab sich zurück in die Weimarer Verhältnisse, die der Herzog durch Gunstbezeigungen freundlicher gestaltete durch die Entbindung von lästigen Diensten, höheres Gehalt und das Haus am Frauenplan.
Zum Ende gab es auch noch Ärger mit dem „Gothaer Räuberpack“ wegen nicht genehmigter Raubdrucke seiner Werke. So blieb die Verbindung zu Gotha ein wichtiges Kapitel der Goethe-Biografie, dennoch eine Liaison auf Zeit.
Sigrid Damm: „Goethes Freunde in Gotha und Weimar“, Insel Verlag, 239 S., 19,95 Euro