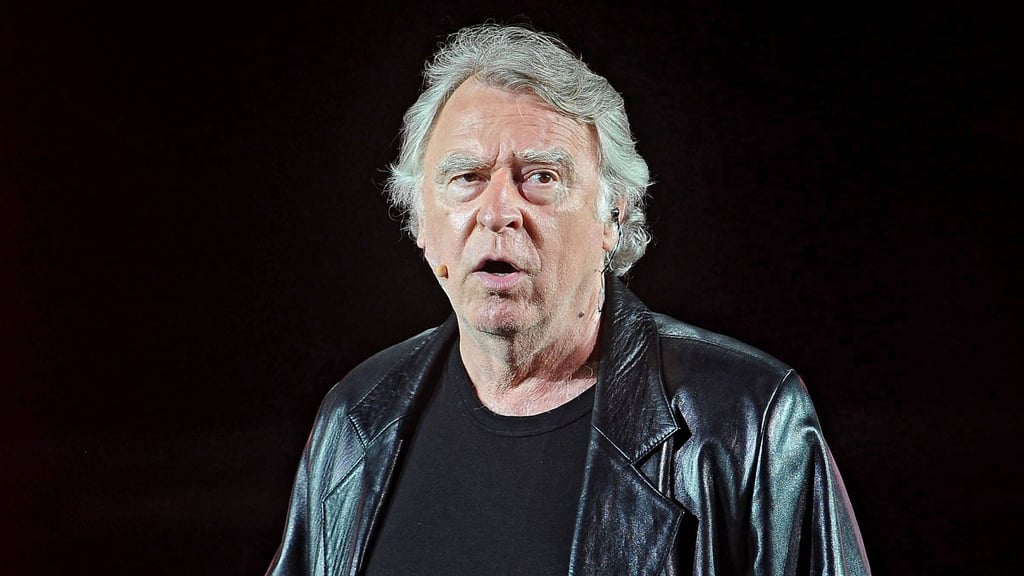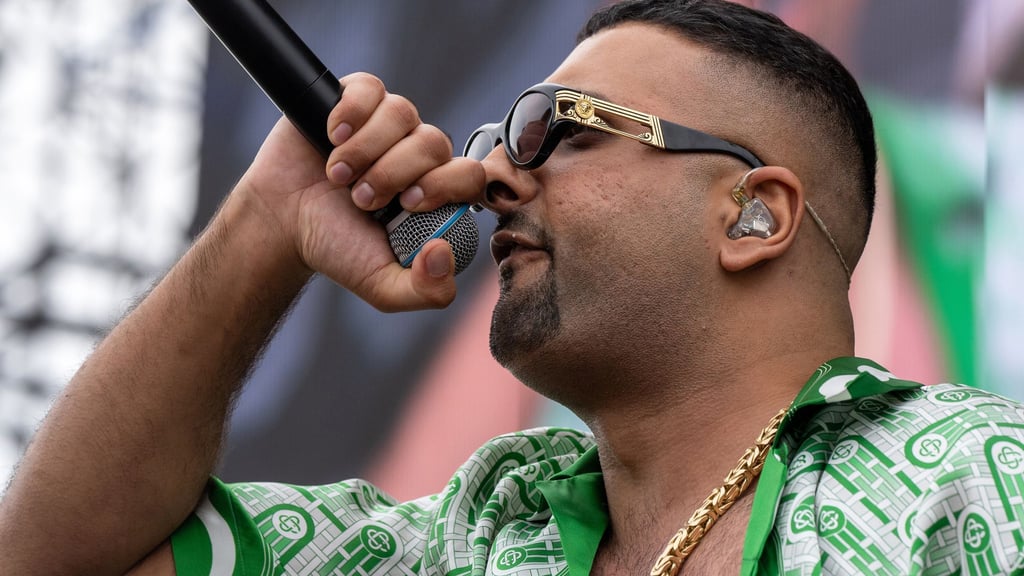Sorben und Wenden in Brandenburg und Sachsen Sorben und Wenden in Brandenburg und Sachsen: Streit um größeres Siedlungsgebiet

Potsdam/dpa - Die geplante Reform des Sorben/Wenden-Gesetzes in Brandenburg sorgt weiter für Streit im Landtag. „Wir können dem Gesetz so nicht zustimmen“, sagte CDU-Fraktionschef Dieter Dombrowski am Dienstag. Nach dem aktuellen Gesetzentwurf hätten die Kommunen keinerlei Mitspracherechte bei der Festsetzung neuer sorbisch/wendischer Siedlungsgebiete. Die Gemeinden müssten an dieser Entscheidung aber beteiligt werden, forderte Dombrowski.
Am Mittwoch soll das neue Sorben/Wenden-Gesetz im Hauptausschuss des Landtags in Potsdam abermals beraten und Ende des Monats verabschiedet werden. In Brandenburg leben etwa 20.000 und in Sachsen etwa 40.000 Angehörige der Minderheit.
Nach dem Willen der Sorben/Wenden soll die Zahl der Orte mit sorbischen Wurzeln per Gesetz auf rund 50 wachsen, um Sprache und Kultur besser pflegen zu können. Das lehnen Städte wie Forst, Senftenberg und Lübben ab. Sie sehen ihr Recht auf kommunale Selbstverwaltung beschnitten und haben dabei die CDU, aber auch den Städte- und Gemeindebund auf ihrer Seite.
Eine automatische Ausdehnung des Siedlungsgebietes um Dutzende Orte werde es mit der Reform nicht geben, erklärte SPD-Fraktionsgeschäftsführer Thomas Kralinski. Vielmehr werde in dem Gesetzentwurf lediglich das „Prozedere“ für ein angepasstes Mitspracherecht beschrieben. Dem müssten dann Verhandlungen in den einzelnen Gemeinden folgen, sagte Kralinski.