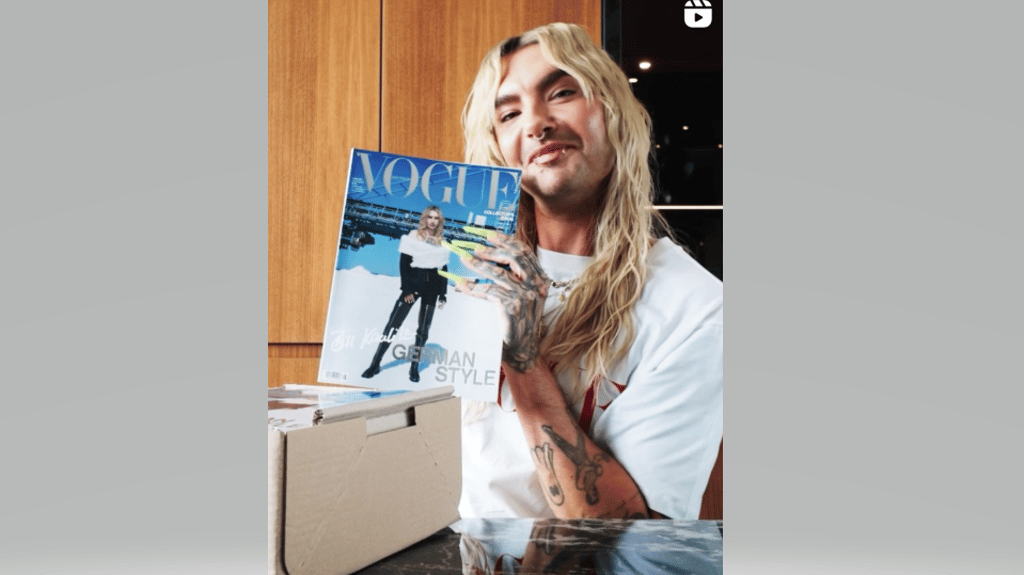Kabarett Kabarett: Herkuleskeule schlägt seit 50 Jahren zu

Dresden/dpa. - Bei den Kabarettisten der Dresdner Herkuleskeulegeht es dieser Tage Schlag auf Schlag. Einmal wird «Die nackteWahrheit» verkündet, ein anderes Mal «Der letzte Schrei». Doch dieaktuellen Programme bilden nur den Rahmen für die große Show: Andiesem Sonntag (1. Mai) hebt sich im Dresdner Schauspielhaus derVorhang für eine Gala, bei der die Künstler um «Keule»-Chef WolfgangSchaller nur indirekt die Hauptrolle spielen. Zum 50. Geburtstag desEnsembles haben sich Kollegen wie Dieter Hildebrandt oderEx-Herkules Wolfgang Stumph angesagt. Nachher ziehen diefeinsinnigen Komödianten zur Party ins Stammhaus der Herkuleskeule.
Was für manche Zeitgenossen heute befremdlich klingen mag: Auchin der DDR wurde viel gelacht - anfangs sogar mit staatlicher Hilfe.Vielerorts gründeten sich um das Jahr 1960 im Arbeiter- und Bauern-Staat Kabaretts, die Missstände im Lande humorvoll und sogar bissigaufs Korn nahmen. Selbst die Nationale Volksarmee hatte eine solcheSpaßtruppe. In den großen Städten entstanden Profi-Ensembles.Nachdem sich der Bitterfelder Weg - eine programmatischeNeuausrichtung der DDR-Kulturpolitik - zunehmend als Sackgasseerwies, verging auch den Kabarettisten manchmal das Lachen. «AnAufhören dachten wir aber nie», erinnert sich Intendant WolfgangSchaller an turbulente Zeiten.
Als der heutige Chef und Cheftexter Schaller 1970 zur «Keule»kam, war das Ensemble schon aus den Kinderschuhen gewachsen. Vorallem Hans Glauche und Fritz Ehlert gaben als «Gustav und Erich» derTruppe ein Gesicht. Nach ihnen fragen Fans noch immer, obwohl diebeiden schon in den Achtziger Jahren starben. Schaller ist davonüberzeugt, dass sie unter anderen politischen Konstellationen sobekannt geworden wären wie Heinz Erhardt im Westen. In jenem TeilDeutschlands konnte die Herkuleskeule erst zwei Jahre vor demMauerfall Wirkung erzielen. Schaller reiste damals mit WolfgangStumph als Gast der Lach- und Schießgesellschaft nach München.
Die Wende leitete die vielleicht schwierigste Phase im Leben derKabarettisten ein. «Plötzlich lebten wir in einem anderen Land, mitanderen Problemen», sagt Schaller. Die Straße gehörte Demonstranten,das Leben fand im Zeitraffer statt. «Eigentlich brauchten wir Zeitzum Nachdenken und Innehalten, doch bei uns musste täglich derVorhang aufgehen.» Damals war das kleine Theater nicht mehr wiesonst üblich jeden Abend gefüllt. «Anfang 1990 war den Leuten dieD-Mark erstmal wichtiger als das Kabarett, wo die D-Mark schonwieder kritisiert wurde», beschreibt der Chef die Lage.
Der Alltag der Kabarettisten geriet oft zur Sisyphos-Arbeit. «Manhat vormittags Texte geschrieben, mittags einstudiert und abendsnicht auf die Bühne gebracht, weil sie schon wieder unaktuellwaren.» Schaller schrieb damals auch ein Lied über den neuenSED-Parteichef Egon Krenz. Zur Aufführung kam es nicht - Krenz warnach der Vollendung des Songs bereits Geschichte. Auch zweiJahrzehnte später halten die Dresdner am politischen Kabarett festund wollen nicht wie viele Kollegen nur die reine Comedy bedienen.Schaller sieht seinen Auftrag darin, «gegenüber der Macht kritischzu bleiben».
Kein leichtes Unterfangen, denn ein Kabarett hat heute mehr alszuvor verschiedene Erwartungen zu bedienen. Schaller sieht Menschenim Saal, die aus Enttäuschung «ihre Freude an der Politik und ihreFreude an der Kritik von Politik» verloren haben. Jedes Programmwird so zum Spagat. Einerseits warten die Leute auf«Schenkelklopfer»,andererseits will die Herkuleskeule sich treubleiben. Für Schallerist gutes Kabarett keine schlichte Lachnummer.
Schauspieler Wolfgang Stumph schwang von 1979 bis 1991 die Keuleund zeichnet nun ein differenziertes Bild von den Chancen desKabaretts. «Nach einer Flaute um 2005 ist jetzt die Realsatireschneller, als die Kabarettisten ihre Programme ändern können.»Spannend sei es auch von 1985-1989 gewesen, nun gebe es die neueZensur - die des Geldes. «Alles muss sich rechnen, auch eineMeinung.» Stumph wünscht seinen Kollegen, dass sie diese Hürdeweiter meistern und trotz der Comedy-Konkurrenz in Stadien weiter «Kleinkunst» mit großer Wirkung machen.