Film und Fernsehen Film und Fernsehen: Götz George hat «mit dem Leben gespielt»
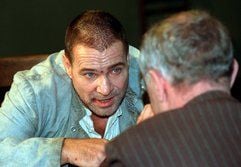
Berlin/dpa. - «Altwerde ich, daran gibt es nichts zu deuteln, ich muss eben meineKondition so gut wie möglich halten, und das klappt», meinte Georgein einem dpa-Gespräch. Auch an seinem 70. Geburtstag, den er amMittwoch (23. Juli) eher widerwillig feiert und wohl wieder flüchtenwird, weil er runde Geburtstage wegen «des Rummels drumherum» nichtausstehen kann, ist der Sohn des großen Schauspieler-Paares HeinrichGeorge und Berta Drews hungrig nach neuen Rollen und Aufgaben.
Dabei hat «Putzi», wie ihn seine Mutter ein Leben lang nannte,sein Klassenziel längst erreicht, Kritiker nennen Götz George «einender wenigen, veritablen Schauspielerstars» in Deutschland. Der aberin seinem Leben nach eigenen Worten auch «immer sehr allein» war, deres «irrsinnig schwer» gehabt und es sich auch selber schwer gemachthabe, der es sich abgewöhnt hat, anderen Menschen zu vertrauen - undder auf die Frage, ob es im Leben überhaupt dauerhafte Beziehungengibt, nach nunmehr 70 Jahren antwortet: «Nee, das war in meinem Lebennie sehr vordergründig», er sei auch mit sich selbst «eigentlich ganzzufrieden». Für sich selbst schreibt er auch seit 30 Jahren Tagebuch(«Jeden Tag eine Seite, mehr habe ich nicht zu sagen»), die nachseinem Willen aber irgendwann vernichtet werden sollen.
«Mit dem Leben gespielt» ist der doppeldeutige Titel der in diesemFrühjahr erschienenen George-Biografie von Torsten Körner (ScherzVerlag), an der der Schauspieler aktiv mitwirkte. Auf seine Arbeitbereitet sich der Preuße und «Berliner Junge» gerne in völligerAbgeschiedenheit in seinem Refugium auf der Mittelmeerinsel Sardinienvor - ohne Handy und Fernseher. Wie ein Computer eingeschaltet wird,weiß er bis heute nicht. Hier nennt ihn auch niemand Schimmi oderSchimanski. In Deutschland ist das ebenso empfindsame wieempfindliche «Raubein» nur noch zum Arbeiten, ansonsten missfällt ihmder öffentliche Umgang hier mit Schauspielern: «Der Deutsche willimmer den Jesus haben, der auf die Schnauze fällt und zugibt: meaculpa.» Daher: «Arbeiten, Steuern zahlen und dann wieder weg.»
Da ist ein Trauma geblieben, die deutschen Medien und George, undauch «diese Geschichte mit Gottschalk». Für George war es schließlichso etwas wie der Verlust der Heimat. «Klaus Löwitsch ist darangestorben», meint er. George hatte zeitweilig Herzrhythmusstörungen.«Ich war völlig unstabil.» Dabei habe er es doch in diesem Land «ohneSkandale, Besäufnisse, Drogen und Kloppereien» so weit gebracht. Dasmuss man doch anerkennen.
Georges bemerkenswerte schauspielerische Wandlungsfähigkeit warbei der Darstellung von Altersrollen auch in früheren Jahren keinProblem für ihn - «das pinkelt der euch in den Sand», meinte dazueinmal der Filmproduzent Markus Trebitsch. Seit über einem halbenJahrhundert ist George «im Geschäft», anfangs auch auf der Bühne, undversucht wohl immer noch, seinem Vater und beruflichen Vorbildgerecht zu werden.
Das darstellerische Spektrum des «ewigen Jungen» mit der«brüllenden Vitalität» und der «kindlichen Gutmütigkeit», der dochimmer auf dem Sprung zu sein scheint, lässt Staunen und nötigt auchRespekt ab. Seine Bandbreite reicht vom Karl-May-Darsteller bis zumKZ-Kommandanten, über einen Alzheimer-Kranken oder blindenKlavierlehrer bis zu einem Boxer oder schwulen Taschendieb und einemhomosexuellen Mörder wie im «Totmacher». Furore machte er auch mitFilmen wie «Schtonk» über die gefälschten Hitler-Tagebücher oder mitder bissigen Münchner-Schickimicki-Satire «Rossini». Gerade hat erdie George-Tabori-Groteske «Mein Kampf» mit dem jungen Tom Schillingabgedreht.
Und natürlich war und ist der «Tatort»-Kommissar Schimanski fürGeorge eine Herausforderung an seinen schauspielerischen Ehrgeiz, dener dort mal mehr oder weniger gut befriedigen konnte - seinheimlicher Wunsch, die populäre Kommissar-Figur in der letzten Folgeals Schwulen zu outen, ging bisher nicht in Erfüllung. Der Wunsch istein innerer Protest gegen das ewige Macho-Klischee. Auf alle Fällehat er mit dem 1981 «geborenen» Ruhrpott-Kommissar SchimanskiFernsehgeschichte geschrieben. Die jüngste Schimanski-Episode«Schicht im Schacht» sahen am vergangenen Sonntag 7,52 MillionenZuschauer im ARD-Gemeinschaftsprogramm, es war der Quotenhit desAbends.
George droht damit das Schicksal vieler großer Mimen, von großenTeilen des TV-Publikums nur noch mit einer Rolle identifiziert zuwerden, und manchmal sprechen ihn gar Journalisten an mit «HerrSchi...ähh...George». Das tut weh. Der Deutsche Fernsehpreis wurdeGeorge aber für sein Lebenswerk verliehen. Und George räumt auch ein,dass die Schimanski-Jahre vor allem in den 80ern für ihn «einewunderbare Zeit» waren, «ein Glücksfall, den ich so in meinem Lebenüber ein Jahrzehnt nicht wieder gehabt habe», wie er jetzt bei derBuchvorstellung seiner Biografie sagte.
Manches ist aber auch schmerzhaft zu erinnern, wie zum Beispielder Tod seines Vaters im sowjetischen Lager Sachsenhausen 1946, einJahrhundertschauspieler («Der Postmeister», «Berlin Alexanderplatz»),der allerdings auch in NS-Propagandafilmen wie «Jud Süß» und«Kolberg» mitgemacht hat und der irgendwo im Wald bei Berlin anonymvergraben wurde, bis ihn der Sohn nach dem Ende der DDR heimholte.
George verschweigt auch nicht bittere Kindheitserinnerungen, wennder Vater nicht davor zurückschreckte, seinen kleinen Sohn mit derReitpeitsche zu züchtigen. Heute hofft George, dass sein Vater sagenwürde: «Na, Kleener, du bist ja nicht so'n schlechter Schauspielerwie ich anfangs gedacht habe.» Götz George ist sichtlich stolz aufseine vielen Rollen und vielseitigen Charaktere, die er dargestellthat: «Das nehme ich mit ins Grab.»




