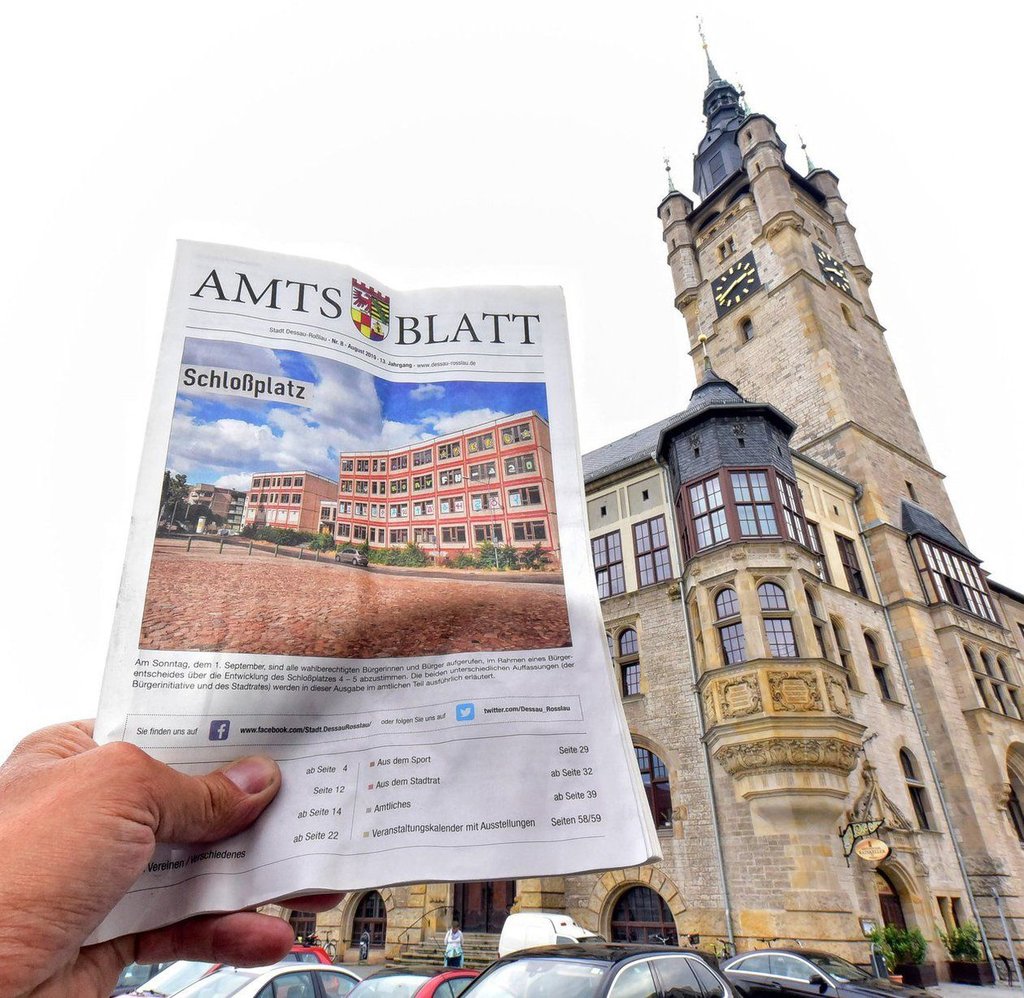Gastronomie Gastronomie: «Ratskeller» ist in vielen Orten dicht
Merseburg/Quedlinburg/MZ. - Ein Kellergewölbe in Merseburg. An den Wänden Fackeln. Sie tauchen den größten Saal in warmes Licht. Daneben Wildschweinfelle - des Herzogs Trophäen der Jagd. In der Mitte eine schwarze Massivholz-Tafel, die Krüge darauf aus Lehm. Und am Kopfende lauscht ein Ritter, was die feiernde Gesellschaft bei Haxe und Bier gerade zu sagen hat.
Im Halbrund des Merseburger Ratskellers geht es noch zu wie im Mittelalter. Oder besser: wieder. Denn jahrelang versperrte eine schwere Holztür die Stufen, die hinab zum Ratskeller führen. Die Stadt als Verpächter wünschte sich einen Betreiber mit Konzept, hatte bei der Suche aber kein Glück. "Es hat mit mehreren Pächtern nicht funktioniert", sagt Antje Benke von der Stadtverwaltung. Hohe Kosten, geringe Einnahmen zwangen fast alle Gastwirte in die Knie.
Zuletzt entschied man sich in der Verwaltung dafür, einen griechischen Gastwirt in das traditionsreichste Lokal der Stadt einziehen zu lassen - Gyros, Schafskäse und Ouzo statt Eisbein, Schnitzel und Bier. Aber auch der Grieche hielt nicht lange durch, scheiterte wie seine Vorgänger an den Ausgaben für Pacht und Nebenkosten. Das riesige Kellergewölbe verschlang mehrere tausend Euro - im Monat. Doch während in Merseburg der Ratskeller heute wieder betrieben wird, versperrt ein schweres Eisengitter in Quedlinburg seit mehr als vier Jahren den Weg hinunter in die ehrwürdigen Gemäuer. Einer, der erlebt hat, wie unrentabel ein Ratskeller tatsächlich werden kann, ist Klaus Becker. Von 1991 bis 2006 bewirtete er seine Gäste auf Quedlinburgs Marktplatz mit "gutbürgerlicher Kost", wie er sagt. Bis 1995 liefen die Geschäfte blendend. Knapp 900 000 Mark Umsatz machte der heute 72-Jährige im Jahr. "Mit dem Euro brach der Umsatz aber ein", erinnert er sich.
Dass Becker in den letzten Jahren nur noch arbeitete, um die Ausgaben zu erwirtschaften, lag wohl auch an den Preissteigerungen. 900 Mark habe er Anfang der 1990er Jahre für die 120 Quadratmeter bezahlt. "Am Ende musste ich monatlich 1 750 Euro an die Stadtkasse überweisen." Hinzu kamen noch die Nebenkosten, die sich in den Jahren fast verdoppelt hätten.
Mit 68 ging der Wirt in Rente. Sein Nachfolger hielt nur noch zwei Jahre durch. Seither werden die Risse im Mauerwerk immer größer und das Interieur verstaubt, während draußen auf dem Marktplatz Passanten und Touristen für quirlige Atmosphäre sorgen.
Eine erneute Verpachtung des Quedlinburger Ratskellers ist derzeit nicht in Sicht - obwohl es zahlreiche Interessenten gibt, die auch bereit sind, eine sechsstellige Summe in das vom Verfall bedrohte Gewölbe zu investieren. Grund: Die Stadt als Eigentümer müsste entweder in die Modernisierung des denkmalgeschützten Gebäudes investieren oder aber eine Zeit lang auf Mieteinnahmen verzichten. "Da stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit", sagte Oberbürgermeister Eberhard Brecht (SPD) vor kurzem.
Selbst wird die Stadt nicht investieren. Es gebe derzeit größere Baustellen in Quedlinburg. "Marktplatzumbau, die Zukunft des Theaters - der Ratskeller ist für mich ein Pilla-Palle-Thema", setzt Brecht Prioritäten. Unterstützung bekommt Quedlinburgs Oberbürgermeister von Jürgen Leindecker, Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds in Sachsen-Anhalt. "Die Städte haben angesichts ihrer finanziellen Situation kaum noch Möglichkeiten, die Ratskeller aufwendig zu erhalten."
Besseres Angebot für Pächter
Diese Haltung kann Wolfgang Schildhauer, Chef des Gaststättenverbands Sachsen-Anhalt, nicht verstehen. "In den Rathäusern hat man noch nicht begriffen, dass der Ratskeller ein Imagegewinn für die Stadt sein kann." Wenn Interessenten schon investieren wollten, um die Gebäude instand zu setzen, dann müsse die Stadt auch ein praktikables Angebot machen. "Im Westen sind die Mieten für Ratskeller deutlich günstiger als hierzulande", sagt Schildhauer.
Für den schleichenden Niedergang macht der Verbandsgeschäftsführer jedoch nicht nur die Rathäuser verantwortlich. Einige Ratskeller hätten den Wandel vom muffigen Keller hin zum angesagten Restaurant noch nicht vollzogen. "Kein Gast setzt sich noch mittags zwei Stunden hin, um eine Haxe zu essen. Heute zählt die schnelle, leichte Küche." Deshalb seien andere Restaurants in unmittelbarer Nähe zum Stadtkern mittlerweile im Vorteil.
Eine durchgängige Küche mit schwerer Kost lohnte sich im Merseburger Ratskeller deshalb noch weniger. Die Situation für die Stadt schien aussichtslos, denn Interessenten gab es zunächst nicht. Was also tun? Den Ratskeller verfallen lassen? Nein, dachte sich die Verwaltung, die das Gewölbe 1994 umfangreich sanieren ließ. Anfang 2011 übernahm Eventmanager Ingolf Kresinksy den Ratskeller. Der 47-Jährige suchte eine neue Herausforderung neben seinem Restaurant, das er seit acht Jahren in Merseburg betreibt. Seitdem läuft es wieder. Zwar nicht durchgängig, immerhin aber an ein paar Tagen im Monat. Immer dann, wenn sich eine große Festgesellschaft angekündigt hat. Kresinksy wirft sich dann in sein rot-weißes Ritterkostüm und bringt die deftig rustikale Küche auf den Tisch, die seit Jahrhunderten traditionell gegessen wird - Schweinsbraten, Eisbein, Weißkraut und Kartoffeln. Mittelalter als Event. Stadt und Gäste sind zufrieden.
Durchgängige Küche lohnt nicht
An sechs Tagen durchgängig zu öffnen, kann sich Kresinksy aber nicht leisten. Die Pacht für die 500 Quadratmeter sei dank des Entgegenkommens der Stadt zwar moderat. Allein das alte Gemäuer würde ihm aber Probleme bereiten. Dieses würde einen beträchtlichen Teil des Umsatzes schlucken. "Ich muss hier selbst im Sommer heizen", sagt der Wirt, der seinen Lebensunterhalt mit seinem anderen Restaurant verdient. Über 16 Grad steigt die Temperatur im Kellergewölbe ohne Heizung nicht. Selbst im Sommer müsste er deshalb kräftig heizen.