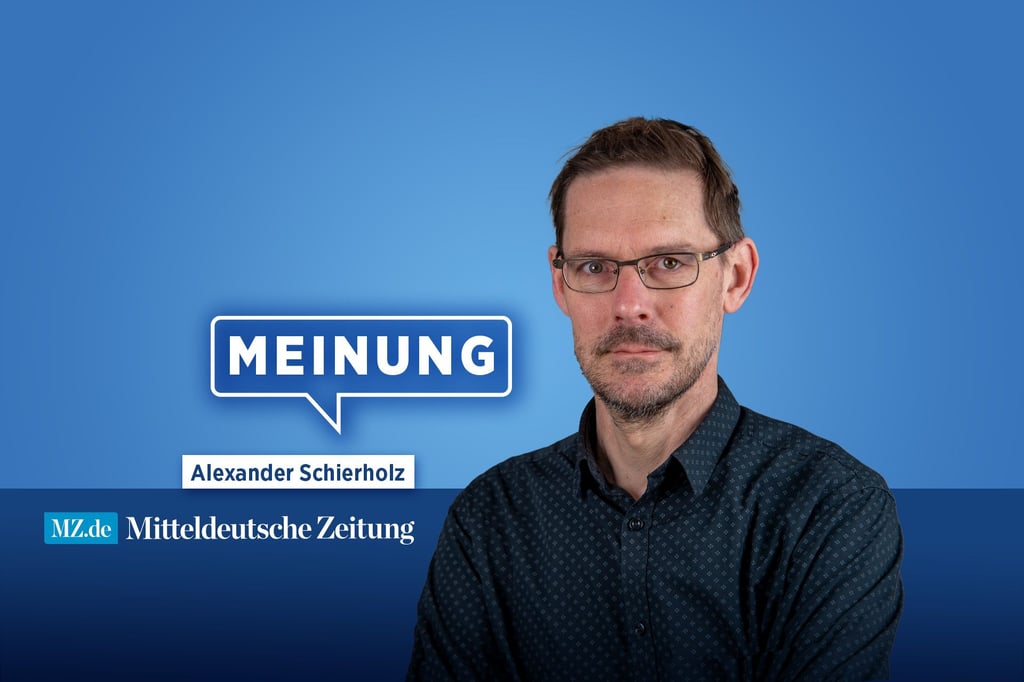Permafrost Permafrost: Die tauenden Böden in der Arktis und in Sibirien gefährden das Klima

Halle (Saale) - Wenn Hans-Wolfgang Hubberten den Permafrost erklärt, dann nutzt er den Vergleich mit der heimischen Tiefkühltruhe. Dort lagern Lebensmittel und sollen möglichst lange frisch bleiben. Fällt die Kühlung aus, taut das eingefrorene Fleisch oder Obst auf und vergammelt. Ähnlich verhält es sich auch mit den Tier- und Pflanzenresten, die seit Jahrtausenden im Permafrost eingeschlossen sind. „Die sind ebenfalls eingefroren und konserviert wie eben in einer Tiefkühltruhe“, erläutert der Permafrost-Forscher des Alfred-Wegener-Institutes in Potsdam (AWI). Taut der Permafrost auf - und das beobachten die Wissenschaftler in zunehmendem Maße - zersetzen Bakterien und Mikroorganismen die Tier- und Pflanzenreste. Das Problem dabei: Der bis dahin eingeschlossene Kohlenstoff wird freigesetzt und gelangt als Methan oder Kohlendioxid in die Atmosphäre. Und beide Treibhausgase tragen bekanntermaßen maßgeblich zur Erderwärmung bei.
Zwei Jahre unter Null Grad
Von Permafrost sprechen Wissenschaftler immer dann, wenn die Temperatur im Boden in mindestens zwei aufeinanderfolgenden Jahren unter Null Grad liegt. Wichtig ist dabei: Bei dem Boden kann es sich um sowohl um Gestein als auch um Sedimente oder Erde mit einem jeweils unterschiedlichen Anteil von Eis handeln. Aus Sicht von Hubberten werden bislang jedoch sowohl die Ausdehnung des Permafrostes als auch die Menge des dort gebundenen Kohlenstoffes unterschätzt. „Der Permafrost unterlagert immerhin ein Viertel der nördlichen Erdhalbkugel. Russland steht sogar zu 50 Prozent auf Permafrost.“ Und die Menge des insgesamt (noch) eingeschlossenen - und gebundenen - Kohlenstoffes ist riesig: Nach Schätzungen sind es 1 600 Gigatonnen. „Das ist die doppelte Menge des Kohlenstoffes in der Atmosphäre.“
Das Problem ist, dass die Folgen von Treibhausgasen aus dem Permafrost in der Vergangenheit nicht in den Klimamodellen berücksichtigt worden sind. „Das Umdenken setzte erst Mitte der 90er Jahre ein, als erste Schätzungen zum Kohlenstoff im Permafrost bekannt wurden“, erklärt Guido Grosse, ebenfalls Forscher am AWI. Mittlerweile ist man sich der potenziellen Gefahr bewusst. „Selbst wenn nur ein Bruchteil des gesamten Kohlenstoffes als Treibhausgas in die Atmosphäre gelangen würde, hätte dies einen Einfluss auf das Klima“, betont Grosse.
Die Potsdamer Experten gehen davon aus, dass die Temperatur in den nächsten 100 Jahren durch die freigesetzten Treibhausgase aus dem Permafrost - je nach Szenario - global zwischen 0,1 und 0,26 Grad Celsius zusätzlich steigt. In der Zeit danach dürfte sich der Anstieg, der nach allen Modellen in der Arktis noch einmal stärker ausfällt, dann deutlich beschleunigen. Das klingt zunächst wenig dramatisch, doch die Ergebnisse des tauenden Permafrostbodens sind heute schon zu beobachten.
So hat sich in der sibirischen Stadt Jakutsk die Tiefe, bis zu der der Boden im Sommer auftaut, in den letzten 20 Jahren von zwei auf drei Meter erhöht. Und das wiederum hat erhebliche Auswirkungen auf die Stabilität vieler Gebäude. „Dort stehen die Stützpfeiler heute nicht mehr fest im Eisboden, sondern im Matsch“, erläutert Hubberten. Doch auch die Energieversorgung ist betroffen. „Manche Pipelines sackten ab, weil der Permafrost auftaut.“ Gleiches gilt für Eisenbahnlinien und Häfen, die auf Permafrost errichtet wurden.
Weitere Informationen zum Thema lesen Sie auf Seite 2.
Der Stabilitätsverlust des Bodens lässt sich dabei durch eine einfache physikalische Gesetzmäßigkeit erklären. So hat Wasser schlicht und einfach neun Prozent weniger Volumen als Eis. Schmilzt also das Eis im Permafrost, sinkt automatisch die Stabilität. Das Eis im Permafrost wirkt außerdem wie ein Zement im Beton. Ist es weg, dann bröselt der lockere Rest auseinander. „Wenn man bedenkt, dass in Sibirien der Anteil des Eises im Permafrost teils 80 bis 90 Prozent beträgt, dann werden auch die Auswirkungen deutlich“, sagt Grosse. So brechen aus einigen Steilküsten in Permafrost-Regionen, in denen der Boden auftaut, große Blöcke heraus. Das liegt auch daran, dass es weniger schützendes Meereis gibt. Die Wellen wiederum werden wegen des steigenden Meeresspiegels immer höher und verstärken die Erosion. So ziehen sich einige Küstenabschnitte in der Arktis pro Jahr um 25 Meter zurück.
Neue Wege für Rentiere
Parallel entstehen auf der ebenen Oberfläche des Geländes Senken, in denen sich das Wasser sammelt - und das hat wiederum weitreichende Konsequenzen. „Dieses Wasser nimmt noch mehr Wärme auf, die im Anschluss noch einfacher in den Permafrostboden eindringt und so das Tauen weiter verstärkt“, erläutert Grosse. Die zunehmende Erwärmung und Vernässung beeinflussen auch die Tier- und Pflanzenwelt. So können Rentierherden teils nicht mehr auf den bekannten Strecken getrieben werden und die Baumgrenze rückt immer weiter Richtung Norden. „Die Landschaft ist viel dynamischer und verletzlicher als wir das lange vermutet haben“, sagt Guido Grosse.
Wichtig ist für die Potsdamer Forscher aber vor allem, dass Wissenschaft und Politik inzwischen die Bedeutung des Themas erkannt haben. „Permafrost ist heute in der Forschung genauso wichtig wie etwa das Meereis und die Eiskappen, das war lange Zeit nicht so“, erklärt Hubberten. „Aber auch Staaten wie die USA, Kanada und Russland haben gemerkt, dass sich da einiges tut.“ Dabei gehe es auch um wirtschaftliche Interessen - wie bei der Rohstoffförderung.
Als Forscher interessiert sich Hubberten gerade für Permafrostböden auf dem Meeresgrund, die während der letzten Eiszeit entstanden sind und dann mit dem Abschmelzen der Eiszeitgletscher sowie dem Meeresspiegelanstieg überspült wurden. Ein Teil des Permafrostbodens ist bis heute auf dem flachen Meeresgrund der Arktis erhalten, taut aber beständig ab. „Wie viel Methan ist dort gebunden? Und wie viel von diesem Methan kann entweichen? Das sind derzeit zwei der brennendsten Fragen“, erklärt der Wissenschaftler. Antworten darauf gibt es vielleicht im Juni 2016, dann veranstaltet das Alfred-Wegener-Institut in Potsdam eine internationale Permafrost-Konferenz. (mz)