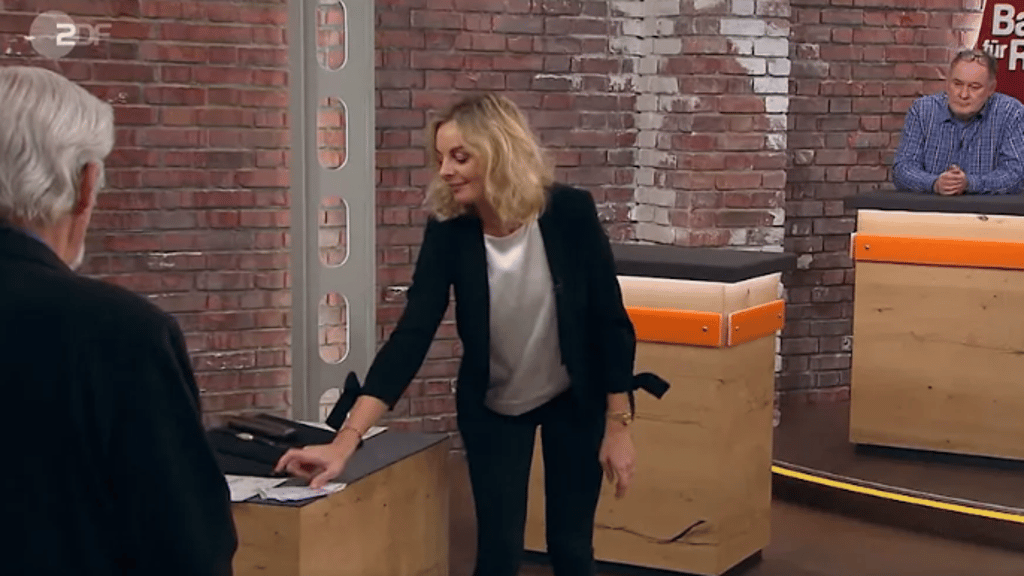Eigene Raumstation in Planung Eigene Raumstation in Planung: Russland steigt 2024 bei ISS-Projekt aus

Moskau - Der Countdown läuft. Noch neun Jahre, dann soll die Internationale Raumstation ISS in ihre Einzelteile zerlegt werden. Behutsam ziehen dann Greifarme den 450-Tonnen-Koloss auseinander - eine spektakuläre Demontage in der Schwerelosigkeit, rund 400 Kilometer über der Erde. So hat es der Beirat der Raumfahrtbehörde Roskosmos in Moskau jetzt entschieden. Die russischen Teile der ISS sollen abgekoppelt und zum Bau eines eigenen Außenpostens verwendet werden. Von 2024 an will Russland seine ehrgeizigen Weltraumpläne wieder allein durchsetzen - und nebenbei ein wenig spionieren.
Russland will eine neue Ära einläuten
Für Russlands Partner gilt das als gute und schlechte Nachricht zugleich. Der Vorteil ist, dass Moskau damit von dem zunächst genannten Datum 2020 abrückt. Vize-Regierungschef Dmitri Rogosin hatte diesen früheren Zeitpunkt vor einigen Wochen genannt - wohl auch als Reaktion auf westliche Sanktionen im Ukraine-Konflikt.
Die Internationale Raumstation ISS gilt seit mehr als 15 Jahren als Außenposten der Menschheit. Gut ein Dutzend Staaten beteiligen sich an dem Projekt, neben Ländern der Europäischen Union auch die USA und Russland. Seit dem Jahr 2000 sind ständig Menschen auf der ISS. 2014 arbeitete auch der Deutsche Alexander Gerst für fast ein halbes Jahr in dem Labor etwa 400 Kilometer über der Erde.
Kommandeur ist meist ein Russe oder US-Amerikaner. Die optimale Besetzung sind sechs Raumfahrer. Sie verbringen jeweils etwa ein halbes Jahr im Orbit. Bei einem Tempo von 28 000 Stundenkilometern erlebt die Mannschaft alle 90 Minuten einen Sonnenaufgang.
Der Nachteil: Das Ende wirkt von russischer Seite als endgültig beschlossen. Aus dem Beschluss wird ganz deutlich: Ein Vierteljahrhundert nach dem kontrollierten Absturz der ausgedienten Raumstation Mir in den Ozean will Moskau bei der Erforschung des Weltalls eine neue Ära einläuten - im Alleingang. An der ISS arbeitet Russland seit 1998 mit den USA, Europa und anderen Staaten zusammen.
Russland beklagt fehlende Spionage-Möglichkeiten
Nach mehr als 15 Jahren sei es für eine Trennung höchste Zeit, meint Wladimir Surdin von der Staatlichen Universität Moskau. Der Unterhalt der Raumstation koste viel Geld, obwohl der Erkenntnisgewinn der Experimente an Bord mittlerweile gering sei. „Russland kann von dort aus noch nicht einmal richtig spionieren, weil uns die Amerikaner ständig über die Schulter schauen“, sagt der Wissenschaftler dem Moskauer Radiosender Echo Moskwy. Für die stolze Raumfahrtnation sei es höchste Zeit, sich neuen Zielen zuzuwenden.
Russlands westliche Partner reagieren zunächst behutsam. Ein Mitarbeiter der europäischen Raumfahrtagentur Esa nennt es erfreulich, dass Moskau wohl doch nicht 2020 ausscheidet. 2024 - das bedeute vier Jahre mehr Planungssicherheit. Aber hinter vorgehaltener Hand äußern doch viele Enttäuschung. Denn nach dem kosmischen Wettlauf zwischen der Sowjetunion und den USA im Kalten Krieg ist die ISS heute auch ein Symbol der Völkerverständigung. Vom Zustand her könne die ISS mindestens bis 2028 betrieben werden, heißt es.
Seit jeher in der Kritik
Tatsache ist aber auch: Die Esa-Mitglieder haben ihrerseits eine Finanzierung der ISS lediglich bis 2017 beschlossen. Darüber hinaus gibt es keinen Konsens. Als größter Beitragszahler will Deutschland die Raumstation zwar ebenfalls bis 2024 nutzen. Andere Esa-Partner sind aber zurückhaltend. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat vor einem Jahr entschieden, die Station mindestens bis 2024 zu erhalten.
Kritik an der Raumstation gibt es seit ihrem Start. Die Gesamtkosten von mehr als 100 Milliarden Euro stünden in keinem Verhältnis zum Nutzen, meinen ISS-Gegner. Keines der bisher mehr als 1200 Experimente auf der fliegenden „Tüftlerbude“ habe Bahnbrechendes zutage gefördert, behaupten sie. Schlagzeilen mache die Station nur mit singenden Astronauten, defekten Toiletten oder als Kulisse für Hollywood-Filme wie das Weltraum-Abenteuer „Gravity“.
Für Deutschland dürfte die Entscheidung von Roskosmos eher eine gute Nachricht sein: Bis 2024 ist die Chance groß, dass nach Alexander Gerst nochmal ein Deutscher zur ISS in ihrer jetzigen Form fliegt. (dpa)