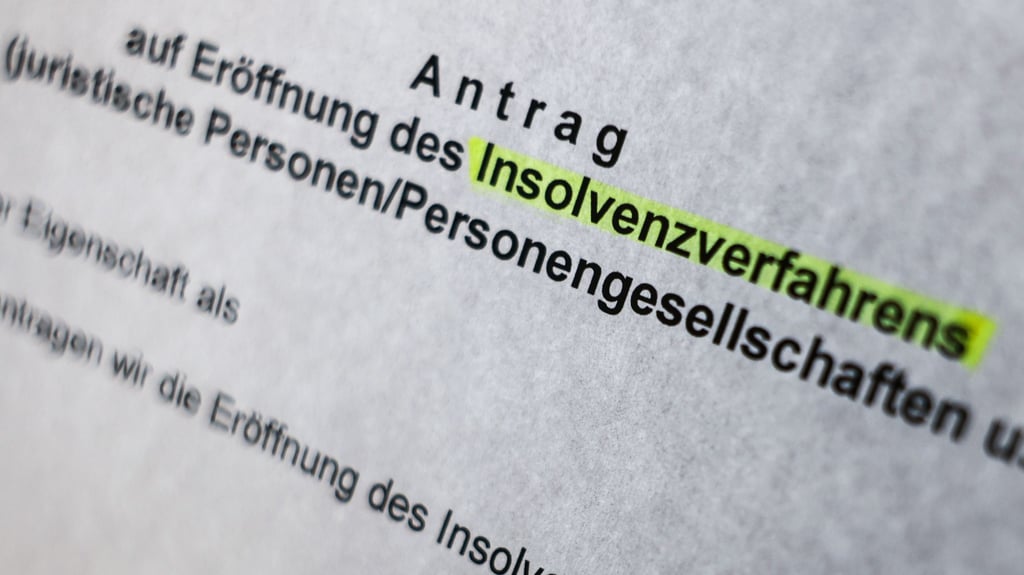Welterbe im Weckglas Welterbe im Weckglas: Wieso Nordkorea 80 Jahre alte Samen in Sachsen-Anhalt bestellt

Gatersleben - Wenn Andreas Börner an seinem Arbeitsplatz die Tür öffnet, dann sieht es dahinter auf den ersten Blick so aus wie bei manch einer Großmutter im Keller. In großen Regalen reihen sich Weckgläser aneinander, sauber aufgestellt und penibel beschriftet.
150.000 Proben umfasst die zweitgrößte europäische Genbank für Kulturpflanzen
Doch werden hier in Gatersleben (Salzlandkreis) nicht Birnen, Kirschen und Stachelbeeren aus dem heimischen Garten gelagert. In den Hochregalen im Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) finden sich stattdessen die Samen von Kulturpflanzen aus fast aller Herren Länder. 150.000 Proben umfasst die zweitgrößte europäische Genbank (die größte ist in St. Petersburg), die ältesten Proben stammen aus den 1920er Jahren. Die Spanne reicht von Getreide über Gemüse und Hülsenfrüchte bis hin zu Kräuter- und Heilpflanzen.
Und damit die Muster möglichst lange für die Nachwelt erhalten bleiben, werden fast alle in insgesamt sechs Kühlräumen bei minus 18 Grad gelagert. Doch nicht nur auf die Temperatur komme es an, sondern auch auf die Luftfeuchtigkeit, erklärt der Wissenschaftler, als er sich seine dicke Jacke überzieht, den großen Türgriff an der Kühlzelle Nummer fünf herunterdrückt und den kahlen Raum betritt. Daher liegt auch hier auf den Samen in jedem der 27 000 Weckgläser ein kleiner Stoffbeutel mit einem Trocknungsmittel, das die Luftfeuchtigkeit auf sechs bis acht Prozent absenkt. „Damit gelingt es uns, die Lebensdauer der Proben über mehrere Jahrzehnte zu strecken.“
Das Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung ist kein Museum
Doch warum müssen überhaupt Proben mit so großem Aufwand eingelagert werden? „Der Mensch hat die Pflanzen immer stärker an seine Bedürfnisse angepasst“, erklärt der 58 Jahre alte Agrarwissenschaftler. Das bringe zwar Vorteile wie höhere Erträge. Der Preis dafür sei aber eine Einschränkung der Vielfalt. „Daher lagern wir nicht nur die Samen von Kulturpflanzen, sondern auch die von verwandten Wildarten, denn dort stecken noch wichtige Informationen drin, die in den Kulturpflanzen oft bereits fehlen.“ Das wiederum kann zu Problemen bei der Züchtung führen. „Für die Züchtung ist eine genetische Vielfalt erforderlich, und die wiederum liegt in Genbanken wie bei uns.“
Doch es geht nicht nur ums Bewahren. „Das ist hier keinesfalls ein Museum“, betont der 58-jährige Genbankmanager, ganz im Gegenteil. „Das ist alles lebendes Material.“ Allerdings sinkt trotz der sehr kühlen und trockenen Umgebung im Laufe der Jahre die Keimfähigkeit der Samen. Deshalb setzen die Gaterslebener Wissenschaftler nicht nur auf die Lagerung, sondern auch auf die regelmäßige Vermehrung. Pro Jahr werden 6.000 bis 8.000 Proben neu angepflanzt, entweder auf dem Feld oder im Gewächshaus.
Samen des Gaterslebener Instituts werden in der Arktis als Backup gelagert
„Das ist alles Handarbeit und damit deutlich aufwendiger als die reine Lagerung in der Kühlzelle“, erklärt der Agrarwissenschaftler, der seit 32 Jahren am Institut tätig ist. Die Forscher versuchen, wenn möglich, auf Pflanzenschutzmittel zu verzichten. „Wir wissen oft ja auch gar nicht, wie die alten Arten darauf reagieren.“ Oberstes Ziel sei jedoch immer, gesunde Sorten zu ernten.
Wie sorgsam das Gaterslebener Institut mit denen umgeht, zeigt der Genbankmanager, als er nach wenigen Minuten aus der Kühlzelle herauskommt. In der Schleuse - einem Zwischenbereich, in dem es mit acht Grad wieder wärmer ist - zeigt er auf eine grüne Plastikkiste, die auf einem Tisch steht. In der Kiste liegen bereits zahlreiche beschriftete Aluminiumtüten, etwa so groß wie Panini-Tüten mit Sammelbildern. „Das geht alles nach Spitzbergen.“ Vor allem das frische Material, wie der 58-Jährige es nennt, wird dafür in die Tüten gefüllt und vakuumverschweißt ein Mal pro Jahr in die Arktis geschickt. „Das sind für uns wichtige Sicherheitsduplikate, die dann in der norwegischen Genbank in Longyearbyen 120 Meter tief im Permafrost-Fels gelagert werden.“
Deutscher Zoologe gelangte 1938 nach Tibet - die Samen lagern heute in Gatersleben
Schon Erhalt und Pflege des Bestandes erfordern also einen hohen Aufwand. An neue Proben zu gelangen, ist noch schwieriger. „Viele Länder schotten sich ab, die letzte Sammelexpedition haben wir 2012 in Jordanien durchgeführt“, berichtet der Agrarwissenschaftler. Dafür seien zwei Jahre Vorbereitung erforderlich gewesen. Ohne einen Partner vor Ort seien solche Unternehmungen ohnehin kaum möglich. In der Regel teilen sich die beteiligten Partner dann hinterher das gewonnene Material.
Doch die Herausforderung und der Reiz, in abgelegene Regionen der Welt vorzustoßen, sind nicht neu. 1938 etwa gelangte Ernst Schäfer nach Tibet. Der deutsche Zoologe ist umstritten, ließ sich von den Nationalsozialisten unterstützen und missachtete viele Auflagen, die Tibets Ministerrat ihm für seine Expedition gemacht hatte. Mit zurück nach Deutschland brachte er damals dann aber nicht nur Hunderte Schädel und Felle von Säugetieren, Schmetterlinge und Mineralien, sondern auch viele Kulturpflanzen - die heute ebenfalls in Gatersleben lagern.
Pjöngjang bittet um die Zusendung von Proben aus der Tibet-Expedition von 1938
„Das ist der Ährensaal“, sagt Börner, als er die Kühlzelle und die Schleuse in dem weitläufigen Gebäudekomplex hinter sich gelassen hat. Wenig später ist klar, wie es zu dem Namen kommt. Der Wissenschaftler öffnet den Deckel eines länglichen Pappkartons mit der Aufschrift „Tibet 1938“. Darunter findet sich eine Getreideähre und ein Reagenzglas mit den entsprechenden Samen. „Wir haben 565 Proben von der Expedition Ernst Schäfers bei uns eingelagert, die meisten Weizen und Gerste.“ Und dass die bis heute nichts von ihrer Bedeutung verloren haben, zeigt ein Schreiben aus Nordkorea, das erst vor wenigen Tagen in Gatersleben eingetroffen ist und das Börner in seinem Büro aus einem Pappordner holt. Darin bittet das Regime in Pjöngjang um die Zusendung einiger Proben aus Schäfers Tibet-Expedition - fast 80 Jahre später. Vermutlich, so Börner, sollen mit dem Material neue Sorten gezüchtet werden, um die genetische Vielfalt zu erhöhen.
Die Sendung nach Nordkorea ist aber kein Einzelfall. Das Institut verschickt jedes Jahr zwischen 40.000 und 50.000 Proben aus seinem Bestand. Pro Probe erhebt das IPK dabei nur eine Bearbeitungsgebühr von zwei Euro. „Wir sehen uns nicht als Eigentümer der Proben an, sondern eher als treuhänderischer Verwalter“, betont Börner. Es gehe schließlich um nichts andere das kulturgeschichtliche Erbe der Menschheit. Daher werde bei der Vergabe von Proben auch kein Land ausgegrenzt. „Landwirtschaft wird überall auf der Welt betrieben und Hunger gibt es auch überall“, sagt der Genbank-Manager und steckt die Anfrage aus Nordkorea zurück in den Pappordner. (mz)