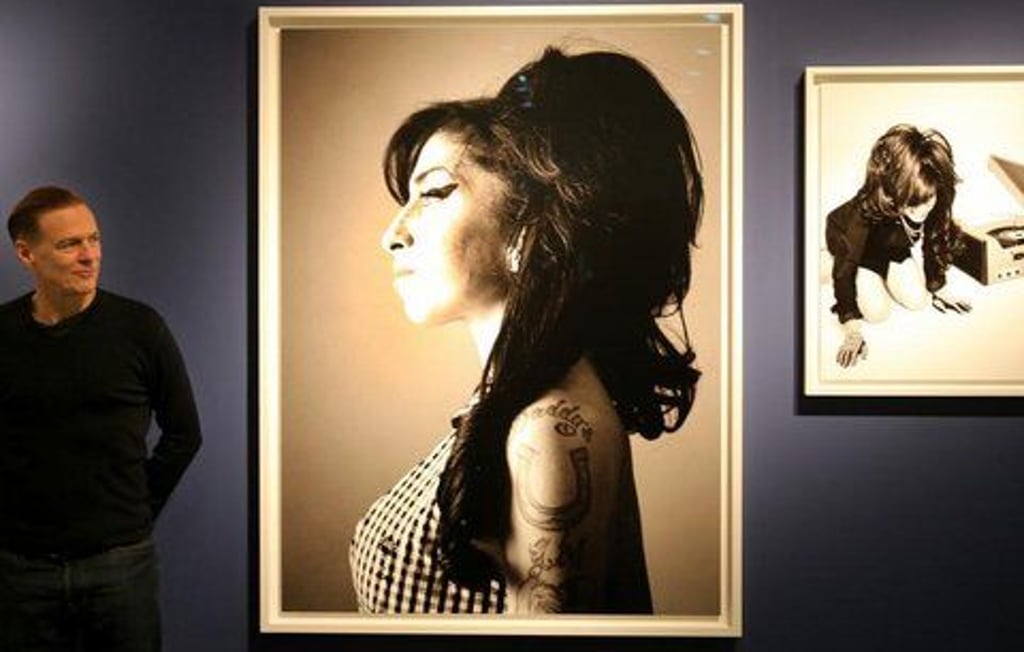Projekt am Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie in Halle Projekt am Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie in Halle: Helfen mit Heilkräutern

Halle (Saale) - In Halle arbeiten moderne Medizinmänner. Das klingt erst einmal abenteuerlich, aber tatsächlich erforschen Wissenschaftler des Leibniz-Institutes für Pflanzenbiochemie (IPB) und vom Institut für Pharmazie der Martin-Luther-Universität äthiopische Medizinalpflanzen. Und machen sich dabei auch das Wissen von afrikanischen Medizinmännern und Heilern zunutze, die ihre Kenntnisse seit Jahrtausenden weitergeben. So konnte man gezielt Pflanzen auswählen und auf ihre Wirksamkeit untersuchen. Im konkreten Fall sind das Pflanzen, die natürliche Wirkstoffe gegen Würmer enthalten.
Hintergrund ist das Hochschulkooperationsprojekt „Welcome to Africa“, an dem die MLU beteiligt ist und Wissenschaftler des IPB einbindet. Ziel ist die Entwicklung von Phytomedikamenten aus äthiopischen Pflanzen.
Parasitenbefall ist in afrikanischen Ländern eine häufige Ursache von Krankheiten. Etwa 1,7 Milliarden Menschen weltweit sind laut Weltgesundheitsorganisation mit Haken-, Peitschen- und Rundwürmern infiziert. „Blähbauch und Mangelernährung, Blutarmut oder innere Blutungen sind Folgen davon“, sagt Norbert Arnold, Forschungsgruppenleiter im Bereich Natur- und Wirkstoffchemie am halleschen Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie (IPB). Damit ist beispielsweise die Entwicklung von Kindern beeinträchtigt, es drohen innere Blutungen, weil der Parasit die Darmzotten befällt.
Normale Medikamente sind zu teuer
Gründe dafür seien in schlechten hygienischen Bedingungen - beispielsweise verunreinigtes Trinkwasser - zu suchen, so die Wissenschaftler am IPB. Das Klima, beispielsweise in Äthiopien, begünstige zudem die Vermehrung der Erreger. „Die normalen Antiwurm-Medikamente können sich Menschen in Äthiopien nicht leisten“, erklärt Arnold. Zumal sich gegen die seit etwa 1940 verfügbaren Medikamente mittlerweile Resistenzen gebildet haben, sodass neue Wirkstoffe gefunden werden müssen. „Die Ideen dafür kommen aus der Natur. Naturstoffe sind deshalb wieder im Kommen“, sagt Arnold.
Experimente mit Modellorganismus
Die Wissenschaftler am IPB haben deshalb einen einfachen Test entwickelt, der auch gut in Afrika angewandt werden kann, um herauszufinden, ob äthiopische Pflanzen potenzielle Wirkstoffkandidaten sind. „Der Wurmtest erfordert keine spezielle Technik oder Chemikalien“, sagt Katrin Franke. Dafür wurden die Fadenwürmer 30 Minuten mit dem entsprechenden Antiwurmmittel konfrontiert. Danach wurde unter dem Mikroskop gezählt, wie viele Würmer überlebt haben. Allerdings wird dabei in Halle nicht mit den eigentlichen Erregern experimentiert, sondern mit einem sogenannten Modellorganismus - dem Fadenwurm Caenorhabditis elegans, erklärt Katrin Franke, wissenschaftliche Mitarbeiterin am IPB. Der Wurm befalle weder Mensch noch Tier, sondern lebe im Boden. Zudem sei er vollständig genetisch charakterisiert und könne, obwohl selbst nicht parasitär, als Modell für alle parasitären Würmer genutzt werden. Und: „Der ist völlig ungefährlich“, sagt Arnold.
Wirkung ist noch ungewiss
Nachdem klar war, dass er auf gängige Antiwurm-Mittel reagiert, haben die Forscher damit begonnen, Rohextrakte aus 20 äthiopischen Heilpflanzen zu testen. In einigen davon konnten mögliche neue Antiwurm-Wirkstoffe gefunden werden. „Wir wissen allerdings noch nicht, wie sie wirken“, sagt Franke. Am Tropeninstitut in der Schweiz, wohin man Proben geschickt habe, sei diese neuen Wirkstoffe zum Beweis an Würmern getestet worden, die auch Menschen befallen können. Die Wirkung sei bestätigt worden.
Ziel sei es nun, die Erkenntnisse einerseits äthiopischen Forschern zugänglich zu machen, um beispielsweise den jeweiligen Wirkstoff chemisch nachbauen und vor Ort neue Medikamente entwickeln zu können. Andererseits soll damit leichter möglich werden, selbst in der heimischen Flora gefundene Gewächse testen zu können. Es sei aber auch denkbar, dass geprüft werde, ob ein kontrollierter Anbau dieser speziellen Pflanzen in Afrika erfolgen könne, erklären Arnold und Franke.
Der Wissensaustausch erfolgt dabei aber nicht nur auf dem Papier, sondern auch persönlich. „Das Projekt ist auch dafür da, aich die örtlichen Gegebenheiten anzuschauen“, sagt Arnold. So reisen Wissenschaftler aus Halle an die Universität von Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens. Afrikanische Forscher kommen im Gegenzug nach Deutschland.