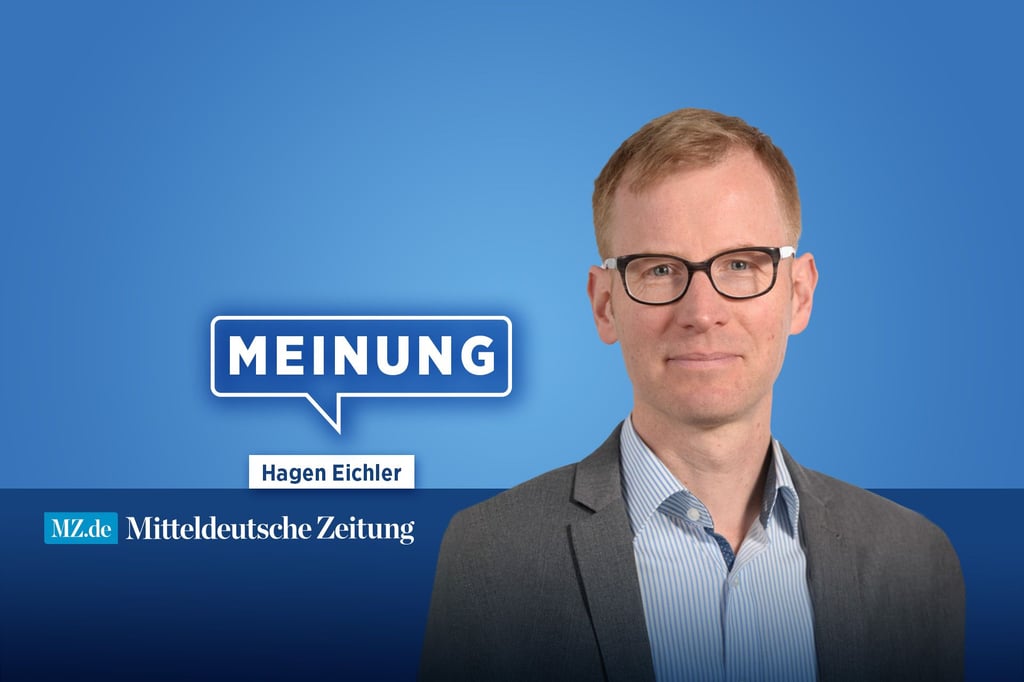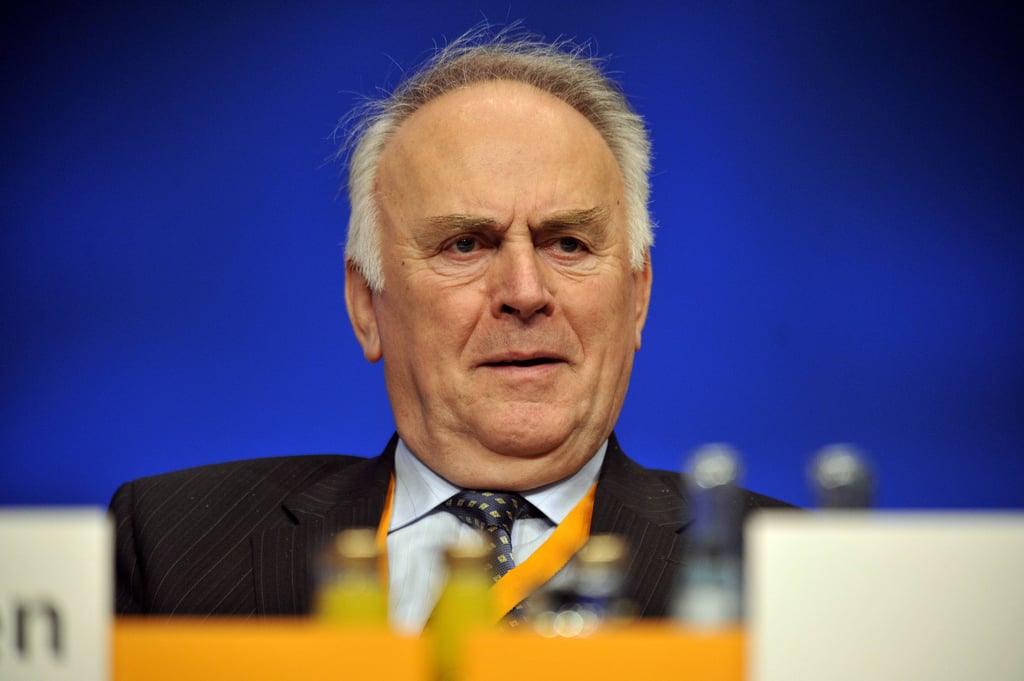Vortrag in KZ-Gedenkstätte Vortrag in KZ-Gedenkstätte: Erinnerungsprobleme in Prettin und Sachsenburg

Prettin - Warum gestaltet es sich so schwierig, in Sachsenburg bei Chemnitz eine neue KZ-Gedenkstätte zu etablieren? Die alte wurde mit der Wende geschlossen. Anna Schüller, Vorstandsmitglied der Geschichtswerkstatt Sachsenburg und Schöpferin des Konzepts für einen künftigen Erinnerungsort in der alten Spinnerei, ging darauf ein, als sie jüngst in der Prettiner KZ-Gedenkstätte Lichtenburg einen Vortrag über Sachsenburg hielt. Aber auch aus der Runde der etwa 30 Besucher des Abends gab es diesbezüglich einige Äußerungen.
Mit „Verbrecher sind Helden“ beschmierten Neonazis 1992 das Denkmal in Sachsenburg. Außerdem verteilte die „Nationalsozialistische Front“ Bielefeld Flugblätter auf dem Gelände. Andere Kreise zweifelten öffentlich an, dass Sachsenburg (frühes KZ der Nazis von 1933 bis 37) überhaupt ein KZ gewesen sei und nicht nur ein „Arbeitslager“.
Lagergemeinschaft aktiv
Ehemalige Häftlinge nahmen dies zum Anlass, sich für das Wiedereinrichten einer Gedenkstätte zu engagieren. 2009/10 gründeten sich die Lagergemeinschaft Sachsenburg und die Jugendinitiative „Klick“. Die Lagergemeinschaft betreut Angehörige, befördert seit zehn Jahren den Sachsenburger Dialog, gibt Broschüren heraus und treibt die Forschung voran.
„Klick“, 2018 in Geschichtswerkstatt Sachsenburg e.V. umgewandelt, führt Workshops zur künstlerischen Auseinandersetzung mit der Historie durch, gestaltet Projekttage, veröffentlicht Materialien, betreut die Webseite www.gedenkstaette-sachsenburg.de und bietet öffentliche Rundgänge an, für die im vorigen Jahr auch Guides ausgebildet wurden.
2012 fand die Sachsenburg Aufnahme ins Sächsische Gedenkstättenstiftungsgesetz - eine Grundvoraussetzung für institutionelle Förderung. Das komplette Fabrikgelände befindet sich in Privatbesitz. Der Stadt Frankenberg, zu der Sachsenburg gehört, wurde jedoch das kleine frühere Zellengebäude überlassen. Das Gedenkstätten-Konzept gibt es seit 2015. 2018 entschied sich der Stadtrat für die minimalste aller möglichen Gedenkstätten-Lösungen: eine Ausstellung auf 180 Quadratmetern (im Zellengebäude), die Häftlingsunterkünfte in dem eigentlichen Fabrik-Komplex werden nicht einbezogen und die Fabrikantenvilla (ebenfalls in Stadtbesitz), welche die Aktivisten sehr gern für die Gedenkstätte mit nutzen möchten, soll abgerissen werden.
2018 beantragte man eine finanzielle Zuwendung bei der Bundes-Gedenkstättenförderung. Die wurde inzwischen abgelehnt. Als Grund verwies die Behörde auf den fragwürdigen Umgang mit der Villa und das Spar-Betreiberkonzept, das heißt die Verortung der Ausstellung sowie den insgesamt geringen Umfang der eingeschlossenen Gebäude. „Derzeit“, so Anna Schüller, „plant die Stadt eine Freiluftausstellung mit mehreren Stationen. Doch momentan ist gar keine Bewegung zu sehen.“
Den Stand der Dinge fasst die 27-Jährige so zusammen: „Das KZ-Gelände ist noch sehr präsent, die baulichen Objekte sind fast vollständig erhalten. Zudem tauchen immer mehr Fundstücke auf, die auf eine sachgerechte Verwahrung warten.“ Auch die Anfragen von Angehörigen ehemaliger Häftlinge nehmen zu, ebenso die Wünsche nach geführten Rundgängen. „Wir haben das KZ also aus der Vergessenheit geholt“, Politik und Stadt haben sich zu einer Gedenkstätte bekannt, aber das alles mündet bislang nicht in konkrete (Sicherungs-)Maßnahmen.
Eindruck geschildert
Unter den Zuhörern des Vortrags in Prettin befanden sich einige, denen Sachsenburg aus eigener Anschauung bekannt oder zumindest ein Begriff ist - weil sie aus der Gegend stammen oder zeitweilig dort zu tun hatten. Sie beschrieben ihren Eindruck, dass Sachsenburg vielen Menschen aus der Chemnitzer Region als KZ lange kein Begriff gewesen sei.
Andere Leute aus dieser Ecke hätten eher vermutetet, dass sich das KZ im nahen Schloss befunden habe statt in der Fabrik. Außerdem identifizierten wohl viele das anfängliche Schutzhaft-Lager nicht mit einem KZ. „Das ist wahrscheinlich auch anderenorts das Schicksal der frühen Konzentrationslager“, bemerkte Anna Schüller dazu.
Melanie Engler sagte, dass sie in dem ganzen Schutzhaft-Wesen der Nazis die erschreckende Tatsache erkenne, wie schnell sich demokratische Verhältnisse nach und nach aushebeln lassen. Anna Schüller - Gymnasiallehrerin für Kunst und Geschichte, die in Geschichtsdidaktik promoviert - fügte hinzu: „Anfangs, als die KZ noch keine Barackenlager waren, sollten sie gar nicht geheim sein. Vielmehr arbeiteten die Nazis mit der Öffentlichkeit. Sie erfüllten eine propagandistische Funktion.“
Und dann halte sich auch noch der Mythos, dass es sich bei den ersten KZ, anders als bei den späteren Vernichtungslagern, um Umerziehungseinrichtungen für politisch und sozial Gestrauchelte gehandelt habe.
Jugendwerkhof im Schloss
Die NVA unterhielt in Frankenberg eine Kaserne, berichtete ein Zeitzeuge, der dort seine Armeezeit verbracht hatte. Das nahe einstige KZ Sachsenburg habe nach seinen Erinnerungen im soldatischen Alltag damals, in den 1970er Jahren, keine Rolle gespielt. In dem Zusammenhang kam die Rede darauf, dass im Schloss auch mal ein DDR-Jugendwerkhof angesiedelt war.
Zwischen ihm und dem einstigen KZ-Objekt soll es wohl Verknüpfungen gegeben haben, bestätigte Anna Schüller.
Zur Echtheit der in Sachsenburg entdeckten und von ihr vorgestellten KZ-Zellen-Inschriften antwortete die Referentin auf eine entsprechende Frage aus dem Publikum, dass dort noch keine bauarchäologischen Untersuchungen stattgefunden haben. In Prettins Lichtenburg hingegen sei das der Fall, ergänzte Melanie Engler.
Hier sei auch nachgewiesen, dass das Gros der Inschriften tatsächlich aus der KZ-Zeit und von Häftllingen stamme. (mz)