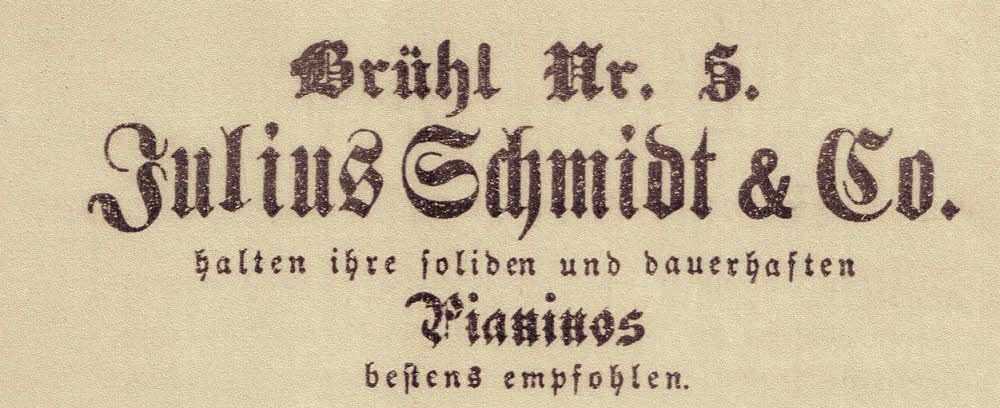Herrschaftszeiten in Zeitz Herrschaftszeiten in Zeitz: Wer etwas auf sich hielt, wohnte am Brühl

Zeitz - Der Gebäudekomplex Brühl 5 in Zeitz ist Geschichte: Vom hochrangigen Denkmal im ältesten Stadtteil von Zeitz bliebt nur ein Schutthaufen übrig. Neben dem herausragenden Denkmalswert war es insbesondere die jahrhundertelange Sozialgeschichte, die Brühl 5 große Bedeutung zumaß. Die Bewohnerstruktur von Brühl 5 unterlag dabei stets dem Wandel der Zeit und war eindrucksvolles Spiegelbild der Stadthistorie.
Herrschaftlich-provinziell muss es im ausgehenden 18. Jahrhundert auf dem großen Grundstück Brühl 5 zugegangen sein. Es ist jene Rokoko-Zeit, die dem Barock noch deutlich nachhing. Nach dem Aussterben der Zeitzer Herzoglinie 1718 verblieb in der Stadt bekanntlich ein umfangreicher Beamtenapparat, der dem kursächsischen Hof in Dresden unterstellt war und das Zeitzer Stiftsgebiet verwaltete.
Brühl in Zeitz erfuhr im späten 17. Jahrhundert eine neue Blütezeit
Der im 18. und frühen 19. Jahrhundert in der Weidmannischen Buchhandlung zu Leipzig verlegte „Churfürstliche Sächsische Hof- und Staats-Kalender“ gibt akribisch Auskunft über die Namen der zahlreichen Stiftsbeamten mitsamt ihren Tätigkeitsbereichen. Deren bevorzugte Wohngegend blieb schon aufgrund der Nähe zur im Schloss Moritzburg untergebrachten Stiftsregierung der Brühl, der in der Regierungszeit von Herzog Moritz im späten 17. Jahrhundert eine neue Blütezeit erfahren hatte.
Überhaupt alles, was Rang und Namen hatte, lebte hinter den häufig mit Dekor verschönerten Fassaden der gepflegten und stattlichen Bürgerhäuser, sei es im Brühl, am Nikolaiplatz oder in der Rahnestraße.
Bedeutende Bewohner des Hauses am Brühl
Viele Jahrzehnte in seinem Amt als Zeitzer „Rechnungssecretarius, Calculator und Stempel-Imposteinnehmer“, später sogar befördert zum „Haupt-Stempel-Imposteinnehmer“, also Haupt-Steuereinnehmer, lässt sich in diesem jährlich erschienenem Kalender Carl Heinrich Weißker nachweisen, der im Haus Brühl 5 wohnte. Angestellt war er beim „Königlich-Sächsischen Stift Naumburg und Zeitz“. Höchstwahrscheinlich unterhielt er nebenbei selbst eine Landwirtschaft.
Mit seiner am 17. September 1819 testamentarisch verfügten Stiftung sorgte der am 16. Juli 1752 in Prettin Geborene dafür, dass man sogar um 1900 noch von ihm sprach. Gemäß seinem letzten Willen fanden sich nämlich jährlich am 16. Juli, an seinem Geburtstag, „vor Untergang der Sonne“ Lehrer und Schülerschaft von der Stadtarmenschule an seiner Grabstätte auf dem unteren Johannisgottesacker ein und sangen das Lied „Ich bin zur Ewigkeit geboren.“, das im evangelischen Zeitzer Gesangbuch unter der Nummer 413 zu finden war. Sogar den Totengräber hatte er für diese Zeremonie mit bedacht, denn er erhielt für das Hinführen zu Weißkers Grab „an diesem Tage 8 Groschen aus der Königlichen Procuratur“. Was war Sinn und Zweck dieser Stiftung?
Pensionierter Kammerrechnungs-Sekretär Weißker hinterließ großes Barvermögen
Der pensionierte Kammerrechnungs-Sekretär Weißker hinterließ ein Barvermögen von 7805 Talern. Von den Kapitalzinsen der Stiftung erhielten sowohl Lehrer als auch Schüler der Stadtarmenschule jährlich einen Anteil ausgezahlt. Sein Ansinnen war einzig und allein die Förderung dieser Bildungseinrichtung. Sein überliefertes Testament lässt klar erkennen, dass er klare Vorstellungen von Schule hegte, da zur soliden Bildung wichtige Voraussetzungen gegeben sein müssen.
Die Stiftung diente zur „besseren Unterhaltung der angestellten Lehrer“, vor allem aber „zum Besten der armen Schulkinder“, denen „in der Welt ihr Fortkommen“ geebnet werden sollte, damit sie „der Stadt nicht zur Last fallen mögen“. Strebsamkeit sollte nach seinem Willen bevorzugt belohnt werden, denn die Kinder, die „Fleiß bezeigen, was zu lernen, ist zur Aufmunterung immer etwas mehr als den Nachlässigen zuzuteilen“. Im Schuljahr 1879/80 konnten beispielsweise 1.173,30 Mark Zinsen aus dem vom Prokuraturamt verwalteten Stiftungsvermögen ihrer Bestimmung zugeführt werden.
Seine einzige noch lebende Tochter hatte er übrigens von der Erbfolge ausgeschlossen, weil sie „wider seinen Willen eine Ehe eingegangen war, die später getrennt wurde“. Außerdem war die Tochter nach Meinung ihres Vaters „jederzeit ungehorsam gewesen“, denn sie hatte sich ihm stets widersetzt und seine Ratschläge nicht befolgt. Weißkers Grabstätte, die sich westlich von der Kapelle auf dem unteren Johannisfriedhof befand, existiert längst nicht mehr. Auch die Stiftung ist mittlerweile seit Ewigkeiten durch die Wirren von Krieg und Geldentwertung erloschen. (mz)