Wittenberg statt Damaskus Wittenberg statt Damaskus: Syrischer Neurologe ist nun Assistenzarzt an Klinik Bosse
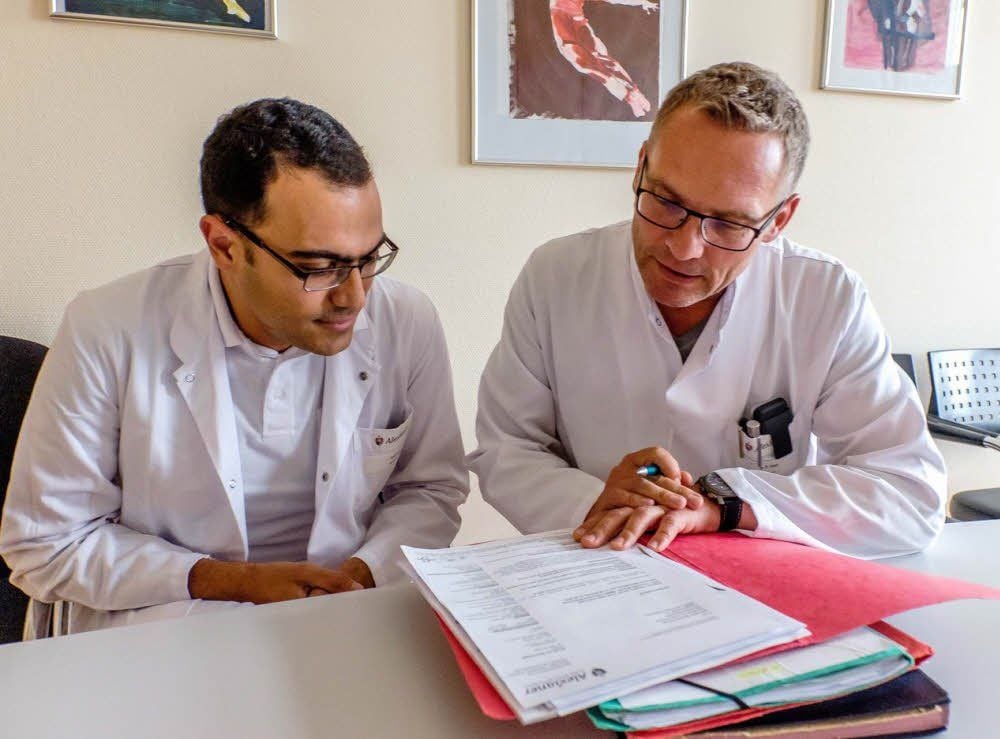
Wittenberg - Der Strom ist limitiert, das Wasser knapp, im Krankenhaus sind viele Fachabteilungen in Unfallstationen umgewandelt, um die Vielzahl der Verletzten zu behandeln. So erlebte Eyad Rajab noch Anfang 2014 Damaskus, die syrische Millionenstadt. Dorthin kam der junge Mann, um nach dem Medizinstudium an der Universität von Aleppo als Assistenzarzt für Neurologie in einem Krankenhaus zu arbeiten. Der nächste Schritt wäre die Facharztausbildung gewesen. Aber diese macht er nun nicht Syrien, sondern in Deutschland, an der Klinik Bosse in Wittenberg.
Bürokratische Hürden überwunden
„Er hat sich bei uns um eine Hospitanz beworben und wir haben zugesagt“, erzählt Philipp Feige, Chefarzt der Klinik für Neurologie. Seit einem Jahr sind er und der 26-jährige Syrer nun Kollegen. „Ich habe damals mehrere Kliniken in Deutschland angeschrieben“, so Eyad Rajab. Er folgte damit einem Rat von syrischen Kollegen, die sich selbst in Deutschland weiterbildeten.
Mit der Zusage aus Wittenberg konnte er bei der deutschen Botschaft in Syrien ein Visum beantragen und die Reise antreten. Der Sommer 2014 begann für Rajab mit einem zweimonatigen Deutsch-Intensivkurs in Berlin, ab Oktober arbeitete er in der Klinik Bosse. „Ich habe mich ganz schnell eingearbeitet und nach einem Monat hat man mir eine Assistenzarzt-Stelle angeboten“, berichtet er.
„Es war ein glücklicher Zufall, dass diese bei uns vakant wurde“, ergänzt sein Chef. So einfach, wie das ein Jahr später klingt, war es freilich nicht. Den Medizinern merkt man die Erleichterung darüber an, vorerst alle bürokratischen Hürden überwunden zu haben. „Das war nicht einfach“, beschreiben sie den langen Weg, um die Berufserlaubnis als Arzt und den Aufenthaltstitel mit der so genannten Blauen Karte zu erhalten.
Angesichts des Mangels an Fachkräften in Deutschland fordern Forschungsinstitute den massenhaften Zuzug von Fachkräften aus dem Ausland. Unter den Asylsuchenden des vergangenen Jahres haben 15 Prozent eigenen Angaben zufolge eine Hochschule besucht. 16 Prozent waren auf einem Gymnasium und 35 Prozent gaben an, eine Mittelschulbildung zu haben.
Elf Prozent haben keine Schule besucht, 24 Prozent eine Grundschule. Diese Informationen gab das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) heraus, sie basieren auf den freiwilligen Antworten bei Befragungen der Flüchtlinge. Gemessen am deutschen Durchschnitt ist das Ausbildungsniveau beim Durchschnitt der Flüchtlinge niedriger. Bei den Flüchtlingen aus Syrien sieht das Bildungsniveau jedoch anders aus.
„Im Gegensatz zu anderen Herkunftsländern erklärten rund 78 Prozent, aus durchschnittlichen oder sehr guten wirtschaftlichen Verhältnissen zu stammen“, so das BAMF. 21 Prozent gaben an, eine Fachhochschule beziehungsweise Universität besucht zu haben, rund 22 Prozent ein Gymnasium und rund 47 Prozent eine Grund- oder Mittelschule. Nur wenige hätten gar keine Schule besucht. (ihi)
Denn obwohl Eyad Rajab beglaubigte Abschriften aller Zeugnisse und Papiere mit nach Deutschland gebracht hatte, bestand das zuständige Landesverwaltungsamt auf eine nochmalige Bestätigung der Universität in Aleppo. Doch wie soll man die von einer Einrichtung erhalten, die es im Prinzip nicht mehr gibt?
80 Prozent der Altstadt von Aleppo liegen in Trümmern, 50 Prozent der Einwohner sind geflohen. Nur beständiges Nachfragen seitens der Wittenberger Klinik konnte eine Lösung herbeiführen, so dass Rajab seit März als Assistenzarzt arbeiten kann.
„Bei aller Gründlichkeit sollte man immer den Einzelfall betrachten“, meint deshalb Chefarzt Feige, der mit seinen Kollegen an der Klinik nicht zum ersten Mal derartige Hürden der Bürokratie nehmen musste. „Bei Fachkräften aus Nicht-EU-Ländern geht das immer wieder aufs Neue los“, ärgert er sich. Dabei sollten Verwaltung und Politik längst wissen, dass ohne Mediziner und Pflegekräfte aus dem Ausland das deutsche Gesundheitssystem nicht mehr arbeiten könnte.
In der Klinik Bosse gibt man den Spezialisten gerne die Chance, hier zu arbeiten. „Meine Kollegen und ich sind sehr zufrieden“, sagt Rajab. Dann zählt er die Nationen in seinem Team auf: Deutschland, Polen, Serbien, Ägypten, Slowakei, Spanien und nun auch Syrien. „Wir sind eine multikulturelle Familie“, so der 26-Jährige, und wie in einer Familie wird auch nach Feierabend viel gemeinsam unternommen.
Radtouren, Ausflüge, Abendessen, Luthers Hochzeit – Dinge, die die ausländischen Mitarbeiter eben nicht mit den Eltern oder Geschwistern unternehmen können, weil die noch in der Heimat sind. Auch die Eltern und der Bruder von Eyad Rajab. Wenn Strom und Internet mal zeitgleich in Syrien funktionieren, hat er Glück und kann Kontakt zu ihnen aufnehmen.
Regelmäßiger geht das mit seiner syrischen Freundin, einer Informatikerin, die ein Stipendium an der TU in Warschau erhalten hat. „Wir sehen uns vor allem auf Skype“, sagt der junge Mann, der oft und viel lacht, auch wenn die Sorge um die Heimat und die Sehnsucht danach geblieben sind. Ihm fehlen die engen Gassen von Damaskus und der Jasminduft.
Schlechtes Gewissen bleibt
„In Deutschland ist es so ruhig“, findet Rajab. Viele Monate konnte er schlecht schlafen. Es war eine irritierende Ruhe. In Damaskus gehörten Raketeneinschläge zur dauerhaften Geräuschkulisse. Und so wie die Erinnerung daran ist auch ein schlechtes Gewissen nicht aus dem Kopf des jungen Mannes zu bekommen.
„Viele Ärzte aus Syrien, die jetzt hier leben und arbeiten, haben das, weil wir unser Land in dieser Situation verlassen haben“, sagt der Mediziner, der sich über solche Fragen in einer Facebook-Gruppe austauscht. 5000 syrische Ärzte, die in Deutschland leben, sind darin aktiv. „Wir geben uns Tipps und Ratschläge“, so Rajab. Fast täglich müsse er Fragen am Telefon beantworten.
Die derzeitige Flüchtlingswelle hat den Neurologen nicht überrascht. Schon als er sein Land verließ, habe sich der Trend dazu abgezeichnet. „Die Menschen wollen doch nur ein würdevolles Leben führen. Ihre Kinder nicht im Krieg und mit ständiger Angst aufwachsen sehen“, meint er. In Syrien gebe es keine Zukunft. „Ich plane auch nicht dafür, wer weiß, was in Syrien noch passiert“, so Rajab. Ein wenig schaut er aber doch voraus und will sich nach fünf Jahren für die Facharztprüfung anmelden.
„Vielleicht haben wir dann sogar eine Oberarztstelle frei“, meint Chefarzt Philipp Feige. „Vielleicht sage ich dann, ich will ein echter Deutscher werden“, blickt der junge Syrer auf die Möglichkeit der Einbürgerung in das Land, das ihm Chancen eröffnete, die seine Heimat ihm nicht mehr geben kann. (mz)




