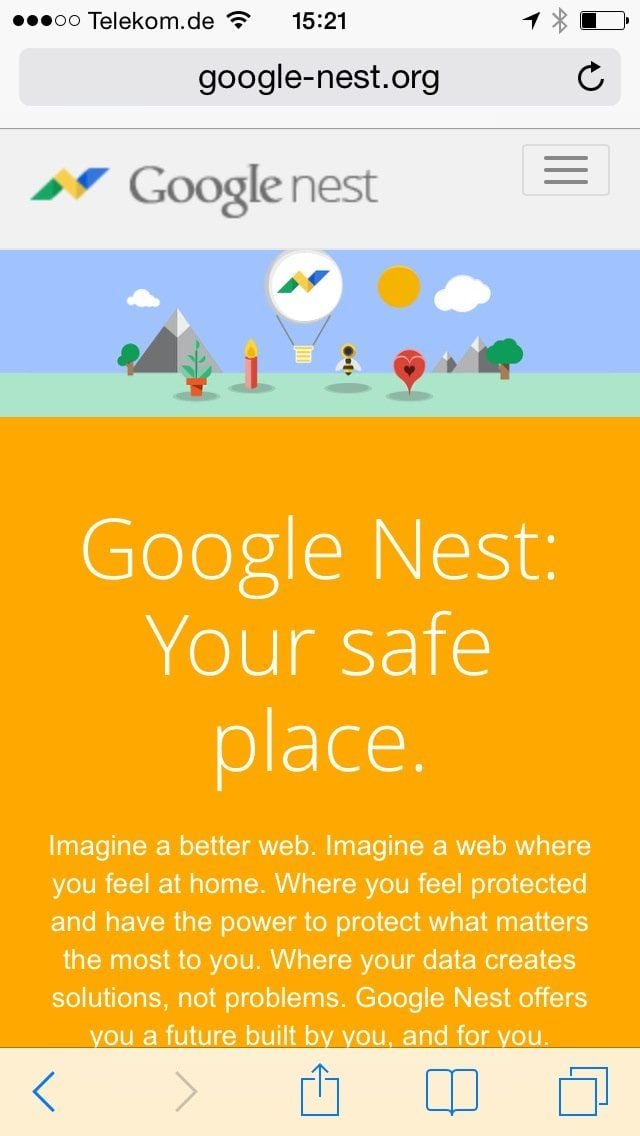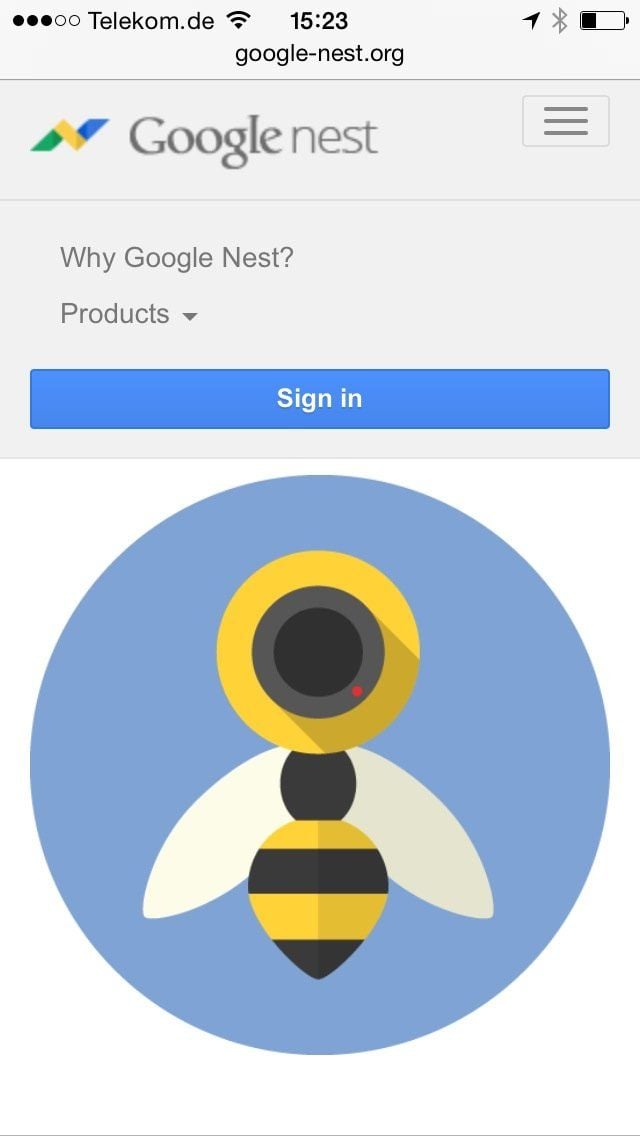RE:PUBLICA 2014 RE:PUBLICA 2014: Eine Biene stürzt ab und Google ist schuld

Berlin - Tag zwei der re:publica 2014 in Berlin. Es berichten: Maike Schultz (@klickbringer), Thomas Kutschbach (@th_kut), Robert John (@rj0hn), Anna Lampert (@AnnaLampert), Christine Badke (@ChristineBadke), Christian Bos.
Lernen ist eines der großen Themen der Internetkonferenz. Aus Fehlern, aus Bedürfnissen, aus netzpolitischen Fragen. Und selbst Profis sind nicht vor Trolldiskussionen auf Twitter gefeit. Unsere Eindrücke des Tages.
Hoax mit Hindernissen
Die Drohne für den Hausgebrauch, gesammelte Daten befreundeter Verstorbener, eine Versicherung gegen Datenmissbrauch, ein Tool, das aufgrund eigener Netzbeiträge die Stimmung errechnet und Leute für eine Umarmung zusammenbringt - trauen Sie einem Unternehmen zu, all das als Dienst anzubieten? Auch wenn dieses Unternehmen das Sammeln von Daten als Geschäftsmodell betreibt?
Da kommt für viele nur Google infrage. Und so präsentierten Gloria Spindle und Paul von Ribbeck „Google Nest“, ein neues Angebot mit Tools, Produkten und Diensten, die eine neue Dimension der privaten Datenfreigabe bedeuten würden. Das ganze war allerdings eine Satire, die von Ribbeck, besser bekannt als „Digital Security Evangelist", politischer Aktivist und früherer taz-Kolumnist, angezettelt hatte, um Bewusstsein für Datenfragen und Privatsphäreeinstellungen im Netz zu schaffen. Die Hoffnung: Eine breite Diskussion im Publikum, auf der ganzen re:publica, in den Medien, in der Welt. Und die Lust auf Guerilla-Aktionen im Stil der „Yes Men“, die am Dienstag zur Eröffnung der Internetkonferenz einen Einblick in ihre subversiven Strategien gegeben hatten, mit denen sie Unternehmen öffentlichkeitswirksam zum Nachdenken zwingen.
Allerdings gab es von Beginn der Produktpräsentation von www.google-nest.org auf der größten re:publica-Bühne an skeptische Stimmen. Einigen erschien die URL schräg, andere fanden das Geschäftsmodell zu unrealistisch, wieder andere schöpften Verdacht, weil man zwischendurch deutlich spürte, dass die beiden sich das Lachen verkneifen mussten.
Dabei hatten sie prominente Unterstützer auch in Parteien gefunden, Schützenhilfe einiger Medien, der Livestream der re:publica wurde ausgesetzt, als es zur Auflösung kam und Google hat den Initiatoren zufolge zugesagt, einstweilen dichtzuhalten bis zum offiziellen Wahrheitslüften um 18 Uhr.
Doch kaum standen die Redner auf der Bühne, schickte Google Deutschland eine Klarstellung über Twitter, dass das Unternehmen nichts mit der Satire zu tun habe.
Mit vielen weiteren Tweets, die wahlweise die Satire lobten oder den Hoax als langweilig einstuften, die thematisierten, wer so blöd war reinzufallen oder über den Google-Tweet sprachen, ist die Diskussion final selbstreferentiell geworden - und der Austausch darüber, wie wir mit unseren Daten umgehen, findet weiter auf anderen Bühnen der Konferenz statt. (cba)
Strukturierte Daten
In der Online-Enzyklopädie Wikipedia wurde in den vergangenen Jahren sehr viel Wissen gesammelt. Das liegt aber hauptsächlich in Textform vor. Seit zwei Jahren gibt es deshalb die Datenbank Wikidata. Darin soll das gesamte Wissen strukturiert aufbereitet werden.
Damit werde die Pflege von Daten in der Wikipedia viel leichter, erklären Lydia Pintscher und Jens Ohlig in ihrem Workshop auf der re:publica. Wenn beispielsweise eine berühmte Person sterbe, werde das traurige Ereignis in der englisch- oder deutschsprachigen Wikipedia sehr schnell eingetragen. Bis der Artikel aber in allen ungefähr 300 Sprachversionen aktualisiert werde, könne es mitunter Monate dauern.
Mit Wikidata müsse dieses Datum hingegen nur noch an einer Stelle in der Datenbank für alle Sprachversionen aktualisiert werden. Eine strukturierte Datenbank hat aber auch noch einen weiteren Vorteil. Die darin enthaltenen Daten können viel einfacher analysiert und weiterverarbeitet werden.
Vorhersagen der Zukunft
Was sich mit solchen frei verfügbaren Daten anstellen lässt, zeigt Jörg Blumtritt in seinem Vortrag "Foresight - die Vorhersage der Zukunft aus der Gegenwart". Im Internet gebe es schon heute einen so gewaltigen Berg an offenen Daten, dass sich daraus brauchbare Aussagen über anstehende Veränderungen und Trends in der Gesellschaft treffen ließen.
Mit einfachen Werkzeugen der Textanalyse sei es möglich, allein aus dem Sprachstil einer Person auf Twitter oder Facebook deren politische Präferenzen ableiten und vorhersagen zu können. Dazu sei es nicht einmal nötig, den Text inhaltlich zu verstehen, sagt Blumtritt.
Antworten auf Fragen des Lebens
Texte inhaltlich verstehen will hingegen IBM mit Watson. Richtig denken soll dieser Computer können. Vor drei Jahren hat Watson die besten Spieler in Jeopardy geschlagen. Heute stehe diese Technik vor dem Markteintritt, sagt Stefan Holtel in seiner Präsentation "Flüssige Demokratie durch die Hintertür?".
Watson könne natürliche Sprache verstehen, unstrukturierte Daten verarbeiten, Zusammenhänge erkennen, fehlende Informationen im Dialog erfragen und beschaffen — und sogar kreativ sein. IBM sieht für solche Rechner einen Milliardenmarkt. Im Laufe dieses Jahres solle Watson für jeden Entwickler verfügbar sein.
Die politischen und gesellschaftlichen Dimensionen solch eines mächtigen Computers seien bisher jedoch kaum diskutiert. Aber Watson werde es tun. Spätestens in ein paar Jahren, sagt Holtel. Und man weiß nicht, ob das eine Drohung ist. (rjo)
Mr. Fragezeichen
Eigentlich dürfte er nicht zu übersehen sein, der Mann mit dem riesengroßen gelben Holz-Fragezeichen. Es dauert trotzdem ein wenig, bis wir ihn an Tag zwei der re:publica dann endlich in den Massen auf dem Gelände ausfindig gemacht haben. Mr. Fragezeichen ist ein gefragter Mann. Richard heißt er, kommt aus den Niederlanden, lebt in Berlin und macht eigentlich Filme. Auf der re:publica stellt der die Besucher vor Herausforderungen: „Sei ein Held und performe etwas“, „Teile deine Gedanken“, „Räum auf“, „Verteile Liebe“ und „Teile etwas mit einem Fremden: Essen, Getränke oder Gold“ heißt es unter anderem auf seiner „Challenge-Liste“.
„Viele sind hier sehr businessmäßig unterwegs. Bei meinen Übungen schmilzt plötzlich die professionelle Fassade, die Persönlichkeiten kommen noch mehr zum Vorschein“, sagt er. Und wer drei Herausforderungen von Mr. Fragezeichen erfolgreich besteht, bekommt ein Geschenk zur Belohnung. „Its Fun!“ (ala)
Laptop-Yoga
Daumen hoch. Wie bei Facebook. Die Schultern zurück. Den Bauch einziehen. Los gehts mit Laptop-Yoga bei Annina Luzie Schmid (@anninaluzie).
Einatmen. Kopf nach links. Ausatmen. Kopf in die Mitte. Einatmen. Kopf nach rechts. Ausatmen Kopf in die Mitte. Ein Arm nach oben. Ein Arm hinter den Rücken. Fünf Atemzüge. Beine übereinanderschlagen. Atmen. Augen zu. Atmen.
Und zum Schluss alle: Ooooooooommmmmmm
Total entspannt verlassen viele die Session - nur unser Nacken schmerzt weiter. Wir haben ja nebenbei noch mitgeschrieben. (ala)
Das Phänomen mit den Taschen
Auf der re:publica ist es ein bisschen wie auf der Berlinale. Also, die Sache mit den Taschen zumindest. Jedes Jahr gibt es eine Neue und alle wollen sie haben. Auf der Internetkonferenz ist es ein Jutebeutel mit dem diesjährigen Motto „Into the Wild“.
Drin ist - neben dem Programm - eine Packung Kekse in Like-Daumen-Form (die sich angesichts der langen Schlangen vor den zu wenigen Essensständen als begehrter Mittagssnack entpuppt).
Die Beutel sind auch Erkennungszeichen jenseits des Festivalgeländes - schon in der U-Bahn erkennt man seine Crowd und sieht, wer zur Netzgemeinde gehört. Doch schon am zweiten Tag ist der Beutel kaum noch zu sehen. Neue Besucher, die keinen mehr ergattern konnten? Oder bietet der Spruch gar zu wenig Identifikationspotenzial? Aber vielleicht ist es eben einfach wie bei der Berlinale: Die wirklich Coolen tragen die Tasche vom letzten Jahr. Knallgelb und mit einem niedlichen Monster drauf. Also bewahren Sie Ihren Beutel gut auf für die #rp15. (mai)
Katzenvideos, Pandabilder und Hollywoodstars in Fellkostümen
Bei "Supergeiler First Kiss - Viralität nur gegen Kohle" diskutierten Juliane Leopold von Zeit Online, Martin Giesler von heute.de, schleckysilberstein.com-Blogger Christian Brandes und WWF-Social-Media-Managerin Melanie Gömmel, was Netz-Inhalte, wie das First-Kiss-Video oder den "Supergeil"-Spot von Edeka, eigentlich viral werden lässt, warum und wann in den sozialen Netzwerken geteilt wird und ob für viele Likes und Retweets immer tief in die Tasche gegriffen werden muss.
Eine Frage sorgte auf Twitter auch noch nach Session-Ende für Diskussionen: „Hat Edeka mit dem Video auch nur ein Brot mehr verkauft?“ - Dumme Frage, meinte Blogger und Journalist Thomas Knüwer, durchaus legitim, viele andere.
Hier können Sie die Diskussion über virale Kampagnen - und nicht zuletzt über Höflichkeit im Netz - in Tweets nachlesen. (ala)
Die Zukunft der Zeitung
Jahrzehnte irrten sich die Journalisten über ihr Geschäft, meint der "Tagesanzeiger"-Redakteur Constantin Seibt: „Sie dachten sie verkaufen Nachrichten. Dabei verkauften sie nur eine Gewohnheit.“ Nämlich die Zeitung zum Kaffee. In seinem Vortrag „Journalismus. Nur besser“ am Mittwochvormittag auf Stage 1 stellte der Schweizer ein paar nachdenkenswerte Thesen auf: Als Journalist tritt man gegen die gesamte Unterhaltungsindustrie des Netzes an, also auch gegen Social Media, Serien und Games.
In diesem Markt funktioniert die bloße Nicht-Enttäuschung nicht mehr. Sondern nur die Erweckung von Begeisterung. Ohne sie hat ein Artikel keine Chance, viral zu werden, ein Blatt keine Chance gelesen zu werden, geschweige denn bezahlt. Ein Abo-Abschluss ist laut Seibt heute keine Routine-Handlung mehr, sondern ein Bekenntnis.
Wie man das bekommt? Eine Zeitung, ob Print oder Online, muss die Atmosphäre eines Clubs haben, zu dem Leute gehören wollen. Und sie muss in der Informationsflut Haltung bewahren. Das ist, so Seibt, vor allem eine Frage der internen Debatte von Verlagen: Wohin wollen wir und wohin nicht? Ohne Debatte kein Profil. Und ohne das keine Zukunft. „Wenn wir schon untergehen, dann wenigstens mit einem Knall“, sagt Seibt dazu. Und bekommt dicken Applaus. (mai)
Cyborgs
Zugegeben: Ich bin als Skeptikerin in diesen Vortrag geraten. Warum lässt sich jemand freiwillig einen Magneten in den Finger implantieren (offiziell, um einen sechsten Sinn zu bekommen)? Und was passiert, wenn dieser Jemand mal irgendwann einen Herzschrittmacher braucht? Vielleicht fördert ja der Cyborgs-Vortrag am Mittwochnachmittag das Verständnis. Hier sollen Stefan Greiner und Nadja Buttendorf vom Berliner Cyborg e.V. über die Implikationen von Maschinenbau am Menschen diskutieren.
Vor allem aber rasseln sie einen langen Reigen von Definitionen und Utopien herunter: Cyborgs seien Hybride aus Mensch und Maschine, entstanden durch „Biohacking auf Open-Source-Basis“. „Auf diese Weise verschwindet der Unterschied zwischen Realität und Virtualität, aber auch die Grenze zwischen Tier und Mensch“, erklärt Buttendorf krächzend und entschuldigt sich sogleich für ihre Heiserkeit. „Sorry, aber wir haben gestern versucht, meine Stimmbänder an Googletranslator anzuschließen“, scherzt sie.
Und welche körperlichen Eingriffe haben die Cyborgs tatsächlich gemacht? „Ich habe einen Magneten im Finger und kann damit elektromagnetische Wellen spüren“, sagt Greiner. Neulich in seiner WG sei das sehr praktisch gewesen, als sie einen Nagel in die Wand hauen wollten und nicht wussten, wo die Stromleitung verläuft. Na dann. (mai)