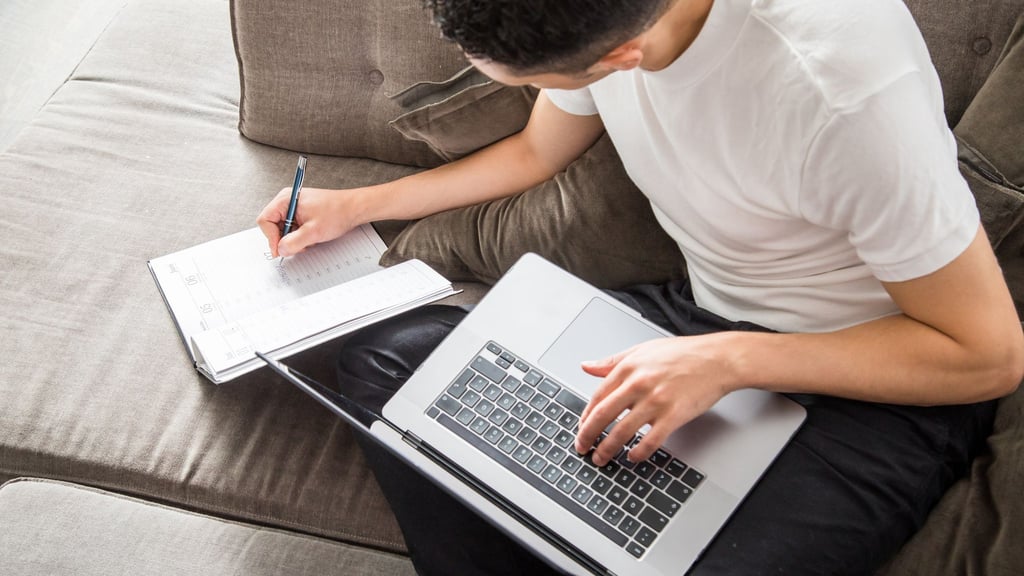"Corona macht Einsamkeit sichtbarer" "Corona macht Einsamkeit sichtbarer": Wie sich Alleinsein auf Menschen auswirkt

Halle (Saale) - Einsamkeit ist nicht erst seit der Corona-Pandemie ein gesellschaftliches Problem, sagen Cäcilia Branz, stellvertretende Leiterin der Abteilung Seelsorge des Krankenhause St. Elisabeth und St. Barbara in Halle, sowie Dr. Anke Schmiedeberg, Psychotherapeutin auf einer onkologischen Station der Klinik. Mit ihnen sprach Bärbel Böttcher.
Viele Menschen fühlen sich einsam. Wird dieses Gefühl durch die Corona-Pandemie noch verstärkt?
Cäcilia Branz: Corona macht die Einsamkeit sichtbarer. Das Thema ist schambesetzt. Niemand gibt gern zu, dass er einsam ist. Doch derzeit betrifft es viele Menschen. Deshalb fällt es dem einzelnen leichter, darüber zu reden. Die Einsamkeit ist aber meist älter als die Corona-Pandemie. Letztere macht sie jedoch gesellschaftsfähiger. Vielleicht ist das sogar ein positiver Effekt dieser Krise.
Anke Schmiedeberg: Wir wissen, dass sich während der Pandemie die Suizidrate in Deutschland signifikant erhöht hat. Menschen, die ohnehin mit psychischen Problemen zu kämpfen haben und die jetzt den ganzen Tag allein zu Hause sind - vielleicht im Home Office arbeiten müssen - könnten jetzt verstärkt leiden.
Ist Einsamkeit nur ein Problem älterer Menschen?
Schmiedeberg: Nein. Auch zahlreiche junge Menschen sind ganz unabhängig von Corona mit Einsamkeit konfrontiert. Viele haben einerseits den Wunsch, eine Familie zu gründen und nicht allein durchs Leben zu gehen. Andererseits fällt es ihnen schwer, sich auf enge zwischenmenschliche Beziehungen einzulassen.
Worin liegen denn dafür die Gründe?
Schmiedeberg: Nähe bedeutet immer, ein Stück Freiheit aufzugeben, Kompromisse einzugehen. Das fällt jungen Menschen, die auf Individualität und Freiheit setzen, zunehmend schwer. Das trifft übrigens auch auf aus Austragen zwischenmenschlicher Konflikte zu. Die Menschen ziehen sich ganz schnell enttäuscht aus Beziehungen zurück, sind nicht mehr bereit, um sie zu kämpfen.
Können soziale Netzwerke Menschen, die sich einsam fühlen, auffangen?
Schmiedeberg: Soziale Medien können das Phänomen kaschieren. Ich treffe Patienten, die sich darüber definieren, im sozialen Medium weit mehr als 100 Freunde zu haben. Fragt man sie jedoch, zu wie vielen davon sie regelmäßig Kontakt haben, schrumpft die Zahl erheblich.
Hinzu kommt, dass man sich ja in der Regel gut überlegt, was gepostet wird. Bestimmt nicht die ganz persönlichen intimen Themen. Schon gar nicht in einer Krise. Ich denke zum Beispiel an Frauen, die monatelang mit einer Risikoschwangerschaft im Krankenhaus liegen und sich vielleicht die Frage stellen, ob sie ein Kind mit einer Behinderung zur Welt bringen möchten. Da geht es um grundlegende ethische und auch religiöse Fragen, die man nicht mal eben im sozialen Medium diskutiert, sondern die man persönlich mit seinen wichtigsten Bezugspersonen klärt.
Einsamkeit belastet die Seele. Kann sie auch körperlich krank machen?
Schmiedeberg: Wenn es der Psyche nicht gut geht, leidet auch der Körper. Suchterkrankungen mit ihren unmittelbaren körperlichen Folgen haben oft einen Ursprung in der Einsamkeit. Viele ertränken ihren Kummer in Alkohol oder nehmen Drogen. Gleichzeitig sehe ich in der Adipositas-Sprechstunde der Klinik junge Menschen mit einem enorm hohen Körpergewicht. Sie erzählen, dass sie ihrer Einsamkeit begegnen, indem sie essen. Das soll ein Stück weit die Leere füllen. Gesundheitliche Folgen kann es aber auch haben, wenn chronisch körperlich kranke Patienten in solch einer depressiven Phase darauf verzichten, ihre Medikamente einzunehmen oder Arztbesuche wahrzunehmen.
Branz: Einsamkeit kann zu Verwahrlosung in ganz unterschiedlicher Form führen. Ungesunde Ernährung oder Bewegungsmangel machen auch krank. Wer keinen Kontakt zu anderen Menschen hat, verliert auf eine Art den Kontakt zu sich selbst, der „lässt sich gehen“, wie wir treffend sagen.
In einigen Kliniken besteht wieder ein Besuchsverbot. Wie belastend ist es für Patienten, keinen Besuch zu bekommen?
Branz: Während des Lockdowns habe ich da eine für mich erstaunliche Beobachtung gemacht. Das Thema Einsamkeit war nämlich gar nicht so präsent, wie man im ersten Moment denken würde. Viele Patienten haben gesagt, sie seien eigentlich ganz froh über die Besuchsregelung, weil sie nun endlich mal zu Ruhe kämen.
Natürlich hat die Seelsorge mehr zu tun gehabt und die Mitarbeiter haben versucht, noch präsenter zu sein. Denn gleichzeitig ist die Aufgeschlossenheit, mit uns Gespräche zu führen, größer geworden. Und was braucht es, um nicht einsam zu sein? Sich im Kontakt mit einem anderen Menschen zu erleben, zu wissen, dass da jemand ist, der eine Art Echo gibt. Da reicht es oft schon, etwas erzählen zu dürfen.
Ich bin auf Stationen unterwegs, auf denen Patienten mitunter mehrere Wochen verbringen. Dort habe ich einige wenige akute Krisensituationen erlebt, Situationen, in denen Patienten wirklich verzweifelt waren und dringend nach ihrem Partner verlangt haben. Das ist dann vom Krankenhaus ermöglicht worden - ohne andere Patienten zu gefährden. (mz)