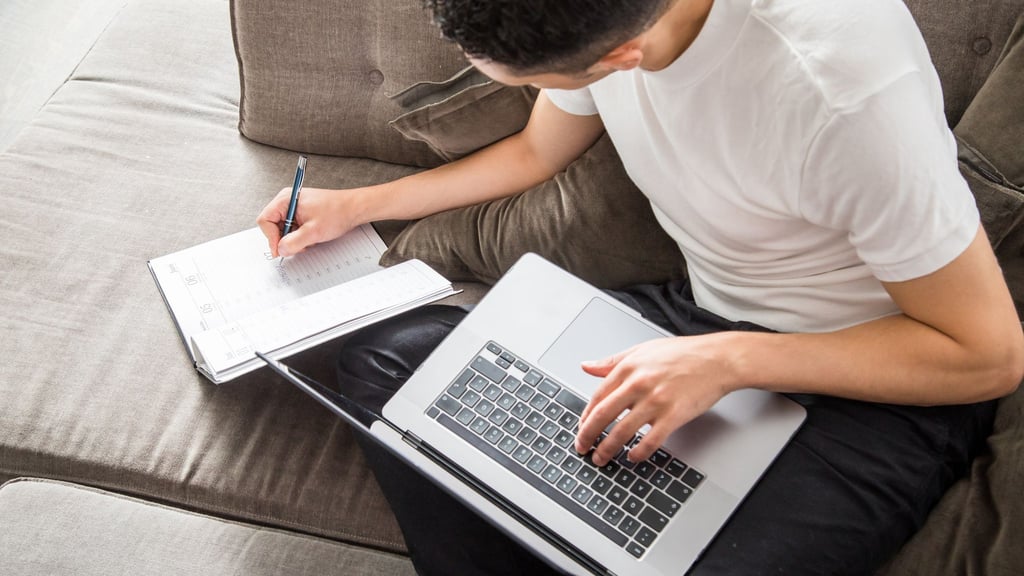Angst abbauen: Stottern offensiv angehen
Gießen/Hamburg/dpa. - Die Schulzeit war für Joachim Haas der absolute Horror. Weil er stotterte, wurde er jahrelang beschimpft und verspottet. «Ich hatte Angst, richtig Panik sogar», erinnert sich der mittlerweile 29-Jährige aus Mücke bei Gießen.
Haas ist bei weitem nicht der einzige, der an dieser Krankheit leidet, bei der der Sprachfluss immer wieder ins Stocken gerät. Selbst Winston Churchill und Marilyn Monroe stotterten, und allein in Deutschland soll es derzeit rund 800 000 Stotterer geben.
«Leider ist gerade das Stottern noch immer mit einer Vielzahl von Vorurteilen behaftet», sagt Maria Schwormstedt, Ärztin bei der Techniker Krankenkasse in Hamburg. «Jugendliche, die nicht flüssig sprechen, werden deshalb oft von Mitschülern ausgegrenzt, gehänselt und von Lehrern unterschätzt.» Mit mangelnder Intelligenz hat Stottern jedoch nichts zu tun.
Wie Stottern entsteht und wodurch es ausgelöst wird, darüber existieren unter Wissenschaftlern noch immer unterschiedliche Ansichten. Sicher ist allerdings, dass Kinder zwischen zwei und fünf Jahren ohne offensichtlichen Anlass damit anfangen. Manche Experten sagen, Stottern sei genetisch bedingt. Andere wiederum glauben, dass es in einer Phase der Sprachentwicklung entsteht, die jedes Kind hat.
«In dieser Phase haben sie alle Unflüssigkeiten beim Sprechen, die sich bei Stotterern allerdings verfestigen», sagt der Logopäde Werner Rauschan aus Saarbrücken. Weil das unflüssige Sprechen dann meist als etwas Negatives bewusst gemacht wird, bedeutet es Stress für das Kind. «Das führt zu Anspannung und Druck, weil die Betroffenen mit Anstrengungen versuchen, das Stottern zu umgehen - was immer noch mehr Stress bedeutet.» Stottern ist auch eine Sache, die viel mit Emotionen zu tun hat. «In entspannten Situationen kann das Stottern durchaus schwächer ausfallen», sagt Rauschan.
Für Joachim Haas änderte sich alles, als er die Schule hinter sich ließ und seine Lehre machte: «Da begann für mich mein zweites Leben.» Ein wichtiger Schritt war für ihn dabei die Therapie nach der Charles-Van-Riper-Methode, bei er lernte, sich nicht zu verstecken. «Man sollte sich direkt mit dem Problem Stottern konfrontieren, offensiv damit umgehen und sich nicht unterlegen fühlen», rät Logopäde Rauschan. «Dann kann man Angst ab- und Selbstbewusstsein aufbauen, auch mit Stottern.»
Schließlich geht es bei dieser Therapie darum, in allen denkbaren Situationen mit den Unterbrechungen im Sprechfluss umzugehen und dabei das Stottern selbstbewusst zuzulassen. Dadurch brauchen sich die Stotterer nicht mehr aus ihrem Reservoir an Tricks bedienen, die das Stottern im Alltag verschleiern - etwa, indem sie kleine Floskeln verwenden oder in bestimmten Situationen schweigen.
Eine Ergänzung zur Therapie kann die Selbsthilfegruppe sein. Bei den Treffen tauschen sich die Stotterer aus und machen auch Leseübungen. «Außerdem gehen wir zusammen in die Stadt und stottern im Kaufhaus oder im Supermarkt Leute an», erzählt Haas. «Dadurch lernen wir, die Situation auszuhalten und mit der Reaktion umzugehen.»
Bundesverband für Logopädie: www.dbl-ev.de
Bundesvereinigung Stotterer-Selbsthilfe: www.bvss.de
Eltern sollten beim Umgang mit stotternden Kindern auf alles verzichten, was sie auf ihre Störung aufmerksam macht. Das verstärke das Stottern noch weiter, warnt der Logopäde Werner Rauschan aus Saarbrücken. Dabei sei es egal, ob es sich um gut gemeinte Hilfestellung oder strenges Eingreifen handelt. Die Eltern sollten stattdessen lernen, sich beim Gespräch mit dem stotternden Kind Zeit zu lassen und ihm das Gefühl zu vermitteln: «Der hört mir jetzt zu.»