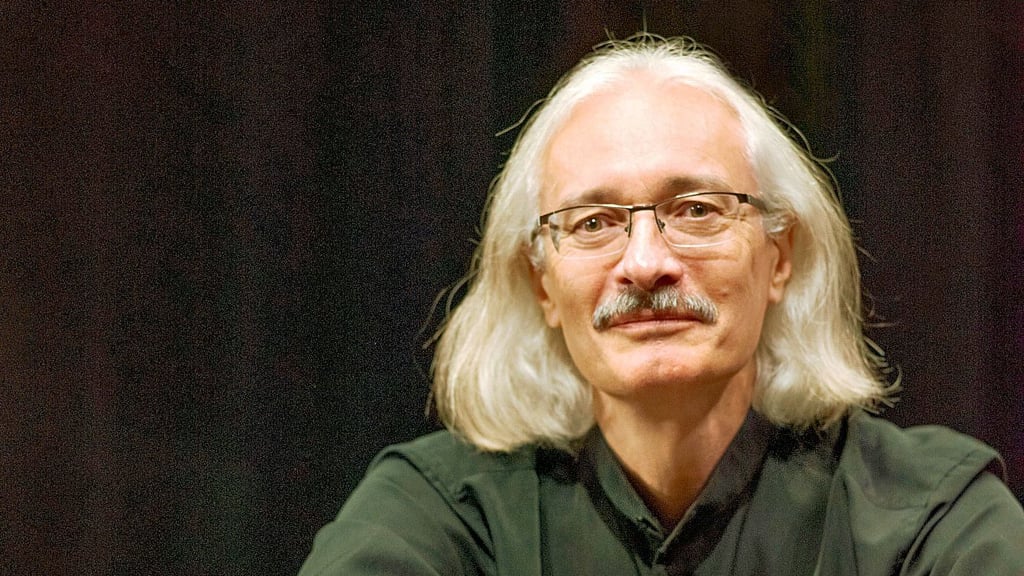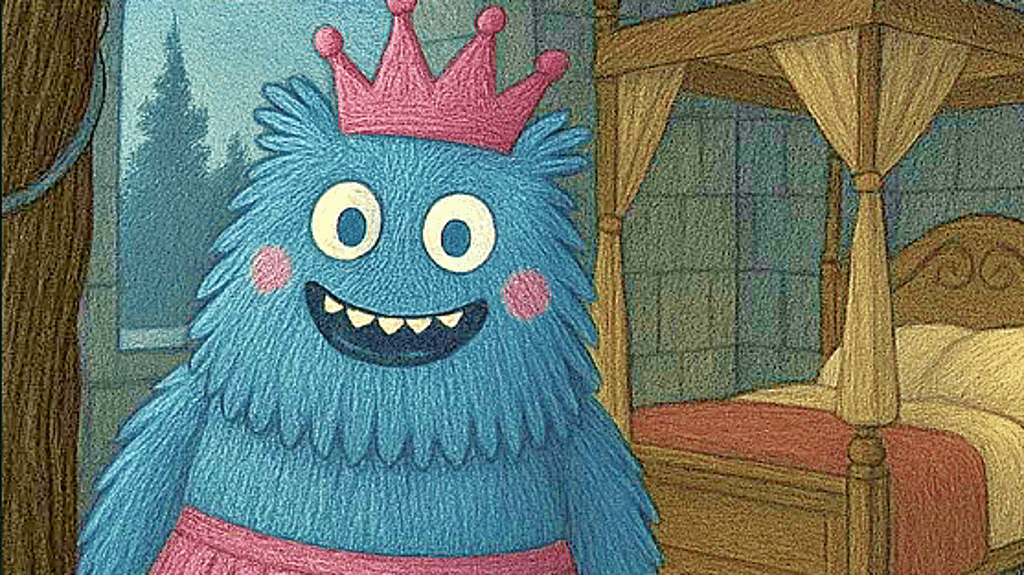Wittenberg Wittenberg: DDR-Museum zeigt Alltag statt Kitsch

WITTENBERG/BERLIN/DPA. - Erich Honeckers Foto hing in fast jederDorfkneipe. In der Tanzbar der obersten Preisklasse «S» hingegen, woTouristen aus dem «kapitalistischen Ausland» beim Drink auf rotenHockern der Bedienung im Glitzerkleid in den Ausschnitt guckten,fehlte das Porträt des Staatsratsvorsitzenden der DDR. Im Laden mitden «Waren des täglichen Bedarfs» bückte sich die Verkäuferin in derbunten Kittelschürze und packte Rotkäppchen-Sekt oder Spargelköpfe imGlas in einen bunten Einkaufsbeutel aus Dederon.
«Die Kundin, die die im gesamten DDR-Alltag überaus wichtigen'Beziehungen' hatte, bezahlte dann ohne zu fragen und ohne zu wissen,mit welcher 'Bückware' die Verkäuferin im Konsum sie beglückt hatte,sofern der Laden nicht mal wieder wegen Warenannahme geschlossenhatte», erzählt Andreas Klose beim Rundgang im «Haus der Geschichte»in Wittenberg (Sachsen-Anhalt). Dies und vieles mehr über dastägliche Leben der Ostdeutschen vor dem Fall der Mauer, aber auchaller Deutschen ab dem Jahr 1920, erfährt der Besucher. Jährlich rund20 000 Menschen aus Ost und West und dem Ausland, auch aus den USAund Japan, kommen hierher.
Sie finden auf drei Etagen 18 originalgetreu mit TausendenSammlerstücken ausgestattete Räume. Dazu zählen komplette Wohnungenwie auch die enge Behausung von Kriegsflüchtlingen. Gezeigt wird derAlltag von Menschen in den 1920er bis 1980er Jahren. Besucher sehenSpielzeug, den schon kultigen Hähnchen-Plaste-Eierbecher und dasMini-Einkaufsnetz aus der DDR wieder. «Sammeln, bewahren, ausstellen,archivieren und dabei wissenschaftlich vorgehen, von Anfang an -darum geht es uns», sagt die Leiterin des Hauses, Christel Panzig.
«Wir möchten ein differenziertes Bild, das den Alltag so zeigt wieer war und das die politische Seite einschließt», sagt sie. «Wirsind aber kein DDR-Museum, sondern wir zeigen die Lebenswelten vonMenschen des 20. Jahrhunderts». Einen ähnlichen Anspruch haben auchandere Orte. So zog es in ein Museum in einem ehemaligen Kino inMalchow in Mecklenburg-Vorpommern seit 1999 mehr als 230 000Menschen, um den Alltag der Ostdeutschen vor 1989 zu verstehen.
Unter dem Motto «Olle DDR» zeigt ein Verein in Apolda in Thüringen16 Räume. Dazu gehören auch eine nachgestellte Zahnarztpraxis, einKlassenzimmer und das Büro eines Parteisekretärs. Im sächsischenTorgau hat der 65-Jährige Manfred Gotthardt in seinem Privathaus aufknapp 200 Quadratmetern viele Gegenstände aus der DDRzusammengetragen. Von Ostalgie aber keine Spur: «Mit geht es um dieDarstellung der Geschehnisse. Urteilen soll dann jeder selbst», sagter und betont: «Hier marschiert keiner mit der roten Fahne durch denHof».
In Wittenberg öffnet unterdessen die Chefin des Hauses abseits derAusstellungsräume die «Schatzkammer», das lebensgeschichtlicheArchiv. In Aktenschränken sind unzählige Tonband- und Wortprotokollevon Menschen unterschiedlicher Herkunft, vom Hausmädchen der 1920erJahre bis zum Chemiefacharbeiter und der Theologin in der DDR nachwissenschaftlichen Kriterien aufgenommen und geordnet worden. Dazukommen fast 50 000 digitalisierte Fotos aus dem Alltag. Selbst dieBedienungsanleitung für den Toaster, der in der DDR Brotröster hieß,ist dabei.
Das bei Touristen bekannteste DDR-Museum ist hingegen in Berlin.2009 besuchten es fast 400 000 Menschen. «Alles wartet darauf,angefasst und erlebt zu werden», heißt es in dem Haus, das zumStöbern in Schubladen einlädt. Die Ausstellung soll künftig auf 1000Quadratmeter vergrößert und mit neuen Angeboten wie einer virtuellenRundfahrt mit dem DDR-Kleinwagen Trabant ergänzt werden.
In Wittenberg würden Besucher aus Ost und West immer wieder auchGemeinsamkeiten im Alltag erkennen, nach einem Rundgang durch dieRäume verständnisvoller reagieren, sagt Panzig. Ihr Mitarbeiter Klosezeigt schmunzelnd auf das nachgebaute Bad. «Die Farbe der 70er Jahrewar orange, da waren wir Deutschen uns eins. Orange war einweltweiter Trend, vermutlich wegen der Flower-Power-Bewegung ausAmerika». So prägen den Raum mit orangefarbenem Linoleum großblumigeVorhänge, auch um die Badewanne. «Ansonsten wurde das, was im Westenmodern war, in der DDR zehn Jahre später nachgebaut», weiß derWittenberger Klose zu berichten.