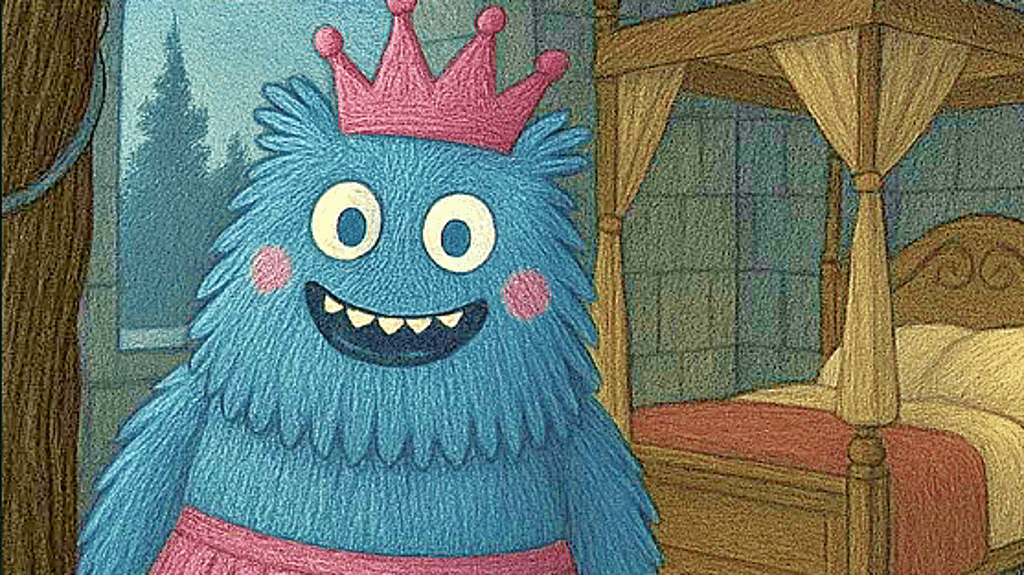Westjournalist in der DDR Westjournalist in der DDR: Alltag in "Absurdistan" voller Hindernisse und Fallstricke

Berlin - „Journalist, stumm, taub, seh- und gehbehindert, für interessante Tätigkeit in einem Ostblockstaat gesucht.“ Mit dieser ironischen Stellenbeschreibung unter Journalisten war damals die DDR gemeint. Staatliche Versuche einer Behinderung oder Beeinflussung freier Berichterstattung der Medien sind jedoch zeitlos, wie die Gegenwart wieder zeigt. Wie ein solcher „Nahkampf“ zwischen akkreditierten Journalisten und Staatsmacht im „ersten deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staat“ DDR aussah, schildert der frühere Korrespondent der „Frankfurter Rundschau“ in der DDR, Karl-Heinz Baum, in seinen Erinnerungen („Kein Indianerspiel - DDR-Reportagen eines Westjournalisten“, Ch. Links Verlag).
Es sind Berichte über einen Journalistenalltag in „Absurdistan“ voller Hindernisse und Fallstricke. Aber „damit die Westdeutschen nicht vergessen, dass hier auch Deutsche leben, arbeite ich hier“, sagte Baum einmal einem Mitarbeiter der britischen Botschaft in der DDR auf dessen Frage, warum er sich das alles antut. Baum habe damit auch an einem „Stück vorweggenommener Einheit“ gearbeitet, bescheinigt ihm Thomas Krüger als Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung und früherer Bürgerrechtler in der DDR in einem Nachwort. Dabei habe er sich in der DDR „kein X für ein U vormachen“ lassen und auch nie die journalistische Distanz des Beobachters verloren.
Karl-Heinz Baum in der DDR: Berichtet mit Mut, List, Tricks und Chuzpe
Baum musste dabei die Spielräume als Journalist in einem repressiven Staat ausbalancieren. Es erforderte oft genug auch Mut, List, Tricks und Chuzpe aus einem Staat zu berichten, in dem fast alles als Geheimsache betrachtet wurde und offene und freie Interviews mit dem „Mann auf der Straße“ grundsätzlich nur mit staatlicher Erlaubnis möglich waren, eine Praxis, die normalerweise nur im Kriegsfall üblich ist. Baums hier noch einmal dokumentierte ungewöhnliche Reportagen rufen nicht nur Alltagsereignisse in der DDR und auch die dramatischen Ereignisse des Wendeherbstes 1989 in Erinnerung, sondern bringen schon damals erstaunlich hellsichtig in wenigen markanten Sätzen historisch gewordene Geschichtsmomente auf den Punkt, was man heute nur mit Erstaunen lesen kann.
Geschrieben unter dem unmittelbaren Eindruck des aktuellen Tagesgeschehens erweist sich der Journalist als beruflicher Chronist des Alltags auch als genauer Beobachter zeithistorischer Ereignisse. Das macht das Buch nicht nur für damalige Zeitgenossen sozusagen als „nostalgische Erinnerungslektüre“ lesenswert. Es ist auch eine lebendig-aufregende Erzählung für die Nachgeborenen über einen untergegangenen Staat und die Gründe für seinen Untergang.
Erinnerungen an DDR Hausbesetzer und Asylantenströme
Baums Reportagen rufen auch nochmal in Erinnerung, dass es auch in der DDR Hausbesetzer (Wohnraumbesetzer) und Asylantenströme gab, die von den DDR-Behörden über den Flughafen Schönefeld nach West-Berlin gleich weitergeschickt wurden - bis zum S-Bahnhof Friedrichstraße in Ost-Berlin mit Bussen und dort durch das kafkaeske Labyrinth der DDR-Grenzpolizei zur Transit-S- und U-Bahn direkt in den Westteil der Stadt. Das waren damals vor allem Libanesen oder Tamilen (Sri Lanka) aus bürgerkriegsgeschüttelten Heimatländern.
Im Falle der Wohnraumbesetzer hatte das „Schwarz-Wohnen“, wie es in der DDR genannt wurde, in den 80er Jahren so zugenommen, dass die SED mit einem zeitweisen Beschluss reagierte, wonach jeder das Recht erhielt, in eine Wohnung einzuziehen, die als leer gemeldet war und nachgewiesenermaßen mehr als ein Vierteljahr leer stand. Dabei handelte es sich allerdings meist um sogenannte Bruchbuden ohne Warmwasser und Innentoilette, die dennoch bei jungen Leuten, auch Künstler und Studenten, sehr begehrt waren.
In zahlreichen Städten wie Leipzig, Halle, Magdeburg, Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) und Ost-Berlin gab es meist baufällige Hinterhäuser oder Seitenflügel, die von parterre bis zum 5. Stock von meist jungen „Besetzern“ in Beschlag genommen wurden. Ein Zentrum dieser „Bewegung“ waren viele heruntergekommene Mietskasernen in Prenzlauer Berg. Nicht viel anders als im westlichen Kreuzberg, wo die Hausbesetzerszene ganze Straßenzüge schließlich vor der „Totalsanierung“, sprich Abbruch, rettete.
Baum zur Görlitzer Altstadt: Die meisten Häuser sind nicht mehr bewohnt, die Türen verrammelt
Besonders schlimm stand es auch um die Bausubstanz der Görlitzer Altstadt. Baum machte sich auch davon selbst ein Bild. In einem Straßenzug kam ihm „das kalte Grausen“, wie er damals (1988) schrieb. „Die meisten Häuser sind nicht mehr bewohnt, die Türen verrammelt. In einem Haus ist vor Jahren schon die Decke eingestürzt, ein Baum wächst heraus, die Wurzeln haben dort Halt gefunden.“
Baum widerspricht auch der weitverbreiteten These, die Maueröffnung im November 1989 sei „aus Versehen“ geschehen. Er verweist dabei auch auf entsprechende öffentliche Äußerungen des damaligen Regierenden Bürgermeisters Walter Momper (SPD). Der damalige ostdeutsche evangelische Konsistorialpräsident Manfred Stolpe habe nach dem Sturz von SED-Chef Erich Honecker ein Gespräch zwischen Momper und dem damaligen SED-Politbüromitglied Günter Schabowski arrangiert, das bereits am 29. Oktober 1989 stattfand, wie Baum schreibt. „Momper erfährt aus berufenem Mund, was auf West-Berlin zukommt und verhängt für alle Mitarbeiter eine Urlaubssperre. Elf Tage später fällt die Mauer.“ (dpa)