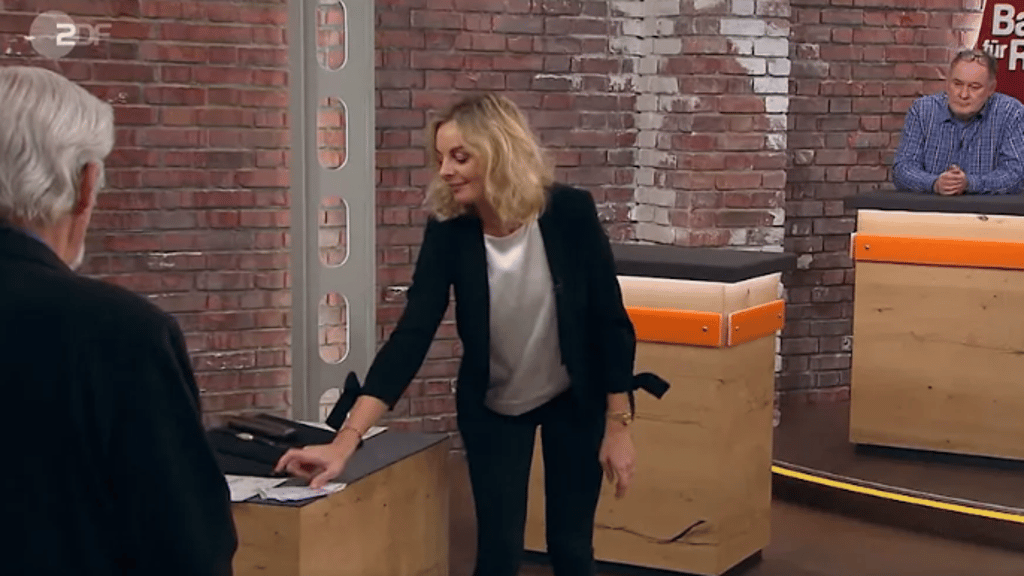Stanley Kubrick Stanley Kubrick: Vom Kerzenlicht der europäischen Aufklärung
Berlin/MZ. - Wachsender Abstand
Kubricks ungebrochene Faszination kann man nun in einer Ausstellung des Deutschen Filmmuseums Frankfurt im Berliner Martin-Gropius-Bau studieren. Von ersten Dokumentarfilmen, in denen der Sohn einer jüdisch-amerikanischen Familie bereits modernen Mythen wie dem Alltag des Boxers Walter Cartier nachspürte, führt ein verwinkelter und dennoch direkter Weg zu seinen Meisterwerken wie "2001: A Space Odyssey", "A Clockwork Orange" und "The Shining". Dass man dabei ein gleichbleibend exzellentes, aber relativ schmales Oeuvre besichtigt, liegt an den stetig wachsenden Abständen zwischen den Filmen. Während der Regisseur von "Spartacus" zu "Lolita" und zu "Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben" nur je zwei Oscar-Verleihungen verstreichen ließ, brauchte er von "Full Metal Jacket" bis zur Arthur-Schnitzler-Adaption "Eyes wide shut" ein Dutzend Jahre.
Das mag auch daran liegen, dass der Regisseur immer weniger zur Akkordarbeit in der Traumfabrik taugte. Der ästhetisch einflussreiche Künstler, der mit nahezu jeder Arbeit ein ganzes Genre neu definierte und den einzigen Oscar ausgerechnet für die Spezialeffekte in seinem epochalen Science-Fiction "2001" gewann, war für seinen Perfektionismus gefürchtet. Wie intensiv er auf Detailfragen achtete, kann man in der Schau unter anderem anhand des War Room aus "Dr. Seltsam" sowie anhand bildnerischer Details aus seiner Kostüm-Ikone "Barry Lyndon" erkennen.
Doch neben dem begehbaren Modell des Computers "Hal 9000" und den pornografischen Dekorationen aus der Korova-Milchbar in "Clockwork Orange" beeindruckt vor allem Kubricks gescheitertes Lebens-Projekt "Napoleon". Dieser Film hätte - als Metapher für die politischen Wirkungen der europäischen Aufklärung - nicht nur seine lebenslange Auseinandersetzung mit dieser Epoche gekrönt, sondern auch die besessene Recherche zum französischen Imperator belohnt.
Eine Spieldauer von 236 Minuten und 41 Sekunden sah der akribische Drehplan vor, den man neben Zettelkästen und einer zum Bersten gefüllten Bibliothek, neben Kostümentwürfen und Drehort-Fotos besichtigen kann. Warum der Film dann doch nicht realisiert wurde, bleibt - trotz des Absagebriefes von Audrey Hepburn, die für die Rolle der Josephine vorgesehen war - letztlich offen. Immerhin taucht Napoleon im Kosmos der Querverweise bereits 1957 bei "Wege des Ruhms" auf, wo sich Kirk Douglas über dessen Skulptur beugt - so, wie es im Plattenladen von "A Clockwork Orange" den Soundtrack zur "Space Odyssey" zu kaufen gibt und sich Clare in "Lolita" als "Spartacus" vorstellt.
Moderne Sinnsuche
Dass Kubrick schließlich auch in seinem futuristischsten Werk mit einer Zimmer-Ausstattung auf das 18. Jahrhundert verwies, dessen Geist er in "Barry Lyndon" teilweise mit Dreharbeiten bei Kerzenlicht einzufangen suchte, erhellt sein Lebensthema: die Sinnsuche des modernen Menschen, die mit der Aufklärung begann.
bis zum 11. April Mi-Mo 10-20 Uhr, Katalog 29,90 Euro